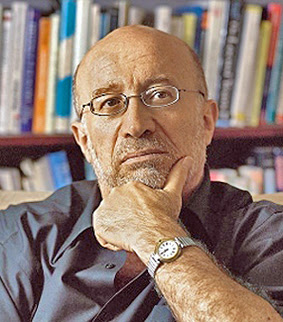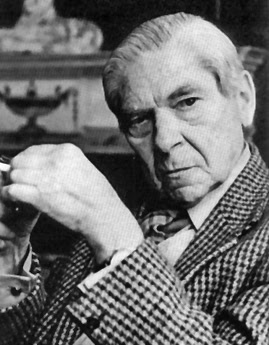Es ist schon bemerkenswert, mit welch simpler Strategie die selbst ernannten „Israelkritiker“ in aller Regel der Feststellung, dass ihre Positionen zum jüdischen Staat antisemitische Züge tragen, zu begegnen versuchen. Den meisten genügt zur Immunisierung ihrer „Kritik“ gewöhnlich die Berufung auf Kronzeugen, die den gleichen Unfug erzählen wie sie selbst, aber schon qua ihres Jüdischseins angeblich gar keine Antisemiten sein
können – so, als wäre Judenhass ein genetischer Defekt und nicht eine Weltanschauung. Mit der Inanspruchnahme dieser Bürgen glauben die Antizionisten, sauber aus dem Schneider zu sein und ihren Antisemitismus ehrbar gemacht zu haben. Nicht einmal die Tatsache, dass sowohl Islamisten als auch Neonazis das Gleiche vertreten wie sie und ihnen daher vernehmlich Beifall zollen, kann ihre Gewissheiten erschüttern, während sie umgekehrt jeden zum Rassisten stempeln, der ihnen und ihrer Masche auf die Schliche kommt, und darüber hinaus im Brustton der Überzeugung verkünden, es seien doch gerade Israel und diejenigen, die es verteidigen, die den Antisemitismus erst schürten. Dass Judenhass mit dem Verhalten von Juden noch nie etwas zu tun hatte, sondern ein auf Projektion beruhender Wahn ist, wollen und können die „Israelkritiker“ nicht erkennen.
Von den besagten Kronzeugen wiederum erfreuen sich diejenigen besonderer Beliebtheit, die es zu einiger Prominenz gebracht haben und dabei am besten auch akademische Titel und Ehrungen vorweisen können. Einer von ihnen ist der britische Historiker Tony Judt, der in Österreich den
Bruno-Kreisky-Preis und in Deutschland den nach Erich Maria Remarque benannten
Friedenspreis der Stadt Osnabrück sowie kürzlich auch den Bremer
Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken zugesprochen bekam. Judt erzählt, was man sowohl hierzulande als auch in der Alpenrepublik gerne hört, und etwaiger Kritik begegnet er mit der Eloquenz eines Universitätsprofessors, der es in seinem Leben schon zu einigen Meriten gebracht hat. Dabei ficht ihn noch nicht einmal an, dass sich sogar Judenfeinde wie der frühere Ku-Klux-Klan-Führer David Duke
auf ihn berufen: „Wir können die Wahrheiten, die wir bereit sind auszusprechen, wenn wir denken, dass sie wahr sind, nicht an den Idiotien von Menschen ausrichten, die eben aus ihren eigenen Gründen zufällig mit uns übereinstimmen“, findet Judt ganz lapidar. Was von diesen „Wahrheiten“ zu halten ist, inwieweit Tony Judt einer Doppelmoral folgt und weshalb er für das Anwachsen des Antisemitismus mitverantwortlich ist, weiß Karl Pfeifer im folgenden Gastbeitrag.
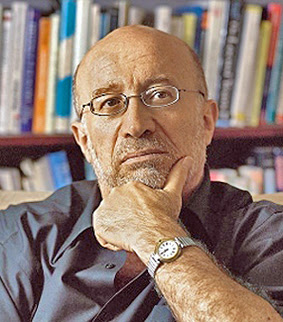 Karl Pfeifer
Karl Pfeifer
Tony Judts „Wahrheit“*Immer wieder werden wir überrascht von Texten, die vor 80 Jahren geschrieben wurden und heute noch aktuell sind. Am 1. September 1927 publizierte der Wiener Schriftsteller Herbert Müller-Guttenbrunner sein
Protokoll über die „Protokolle der Weisen von Zion“. (1) Er brachte drei Einwände gegen diese zaristische Fälschung vor und befand, diese genügten bereits, um
„dem Werke den Boden der Dummheit, auf den es gegründet ist, zu entziehen“:
„Man könnte die Akten über die Protokolle der Weisen von Zion mit einem Schlusspunkt versehen. Aber um der vielen zurechnungsfähigen und intelligenten Menschen willen, die die Technik des Schwindels, der zur Verhetzung der Menschen verwendet wird, noch nicht weghaben, die im ehrlichen Entsetzen über die heutigen Zustände auf Erden nach deren Urhebern fragen und sich in sinnloser Wut auf die ihnen von den wahren, aber anonymen Urhebern als vermeintliche Urheber präsentierten Juden stürzen – um dieser Menschen willen sei näher auf den Mist eingegangen.“Es kann nicht überraschen, wenn ausgewiesene Antisemiten wie David Duke (2) diesen Mist, von dem schon Müller-Guttenbrunner sprach, wieder aufbereiten, um ihren Anhängern zu erklären, die USA würden von einer „zionistisch besetzten Regierung“ (
„Zionist Occupied Government“ – ZOG) geführt. Wenn sich aber ein in Europa anerkannter und preisgekrönter Historiker wie Tony Judt (Foto) dazu hergibt, den gleichen Mist wie Duke zu verzapfen, dann verdient das eine genauere Analyse. Am 12. Oktober 2007 fand an der Universität Chicago eine Konferenz über „akademische Freiheit“ und zur Unterstützung von Norman Finkelstein (3) statt. Diese Konferenz ging von der Annahme aus, dass die nämliche akademische Freiheit im Allgemeinen und Finkelstein im Besonderen einem illegitimen und mächtigen Angriff der Israel-Lobby ausgesetzt sind. Judt hielt dabei eine Ansprache, die
auf der Website des Monthly Review-Zines zu hören und ausschnittsweise
bei Engage Online zu lesen ist. Er sagte unter anderem:
„Wenn Sie aufstehen und sagen, wie ich es sage und vielleicht auch jemand anderes es sagen wird, dass es eine Israel-Lobby gibt, dass es eine Reihe von jüdischen Organisationen gibt, die sowohl offen als auch im Verborgenen arbeiten, um gewisse Arten von Unterhaltungen, gewisse Arten von Kritik usw. zu verhindern, dann kommen Sie kaum umhin, zu sagen, dass es eine De-facto-Verschwörung, oder, wenn Sie so wollen, ein Komplott oder eine Zusammenarbeit gibt, um die öffentliche Politik zu hindern, dass sie sich in eine Richtung bewegt oder in eine gewisse Richtung gedrängt wird – und das hört sich schrecklich an, wissen Sie, es klingt nach den ‚Protokollen der Weisen von Zion’ und nach der Verschwörungstheorie der ‚zionistisch besetzten Regierung’ usw. – Nun, wenn sich das so anhört, dann ist es unglücklich, aber es ist eben so. Wir können die Wahrheiten, die wir bereit sind auszusprechen, wenn wir denken, dass sie wahr sind, nicht an den Idiotien von Menschen ausrichten, die eben aus ihren eigenen Gründen zufällig mit uns übereinstimmen.
Es kann wohl wahr sein – ich weiß das, weil ich von ihm eine E-Mail erhalten habe –, dass David Duke denkt, in John Mearsheimer, Stephen Walt oder mir Alliierte gefunden zu haben. Doch ich erinnere Sie daran, was Arthur Koestler (4) in der Carnegie Hall sagte, als er 1948 gefragt wurde: ‚Warum kritisieren Sie Stalin? Wissen Sie nicht, dass es Menschen gibt in diesem Land, Nixon und die damals noch nicht so genannten McCarthyisten, die auch Antikommunisten sind und Ihren Antikommunismus zu ihrem Vorteil nutzen werden?’ Und Koestlers Antwort war die Antwort, von der ich denke, dass wir sie in Erinnerung behalten sollten, wenn wir beschuldigt werden, Geiseln verrückter Antisemiten zu sein. Die Antwort war: Sie können nichts tun, wenn Leute aus ihren eigenen Gründen mit Ihnen übereinstimmen – Sie können nichts tun, wenn Idioten mit ihren stehen gebliebenen politischen Uhren einmal innerhalb von 24 Stunden die gleiche Zeit zeigen wie Sie. Sie müssen aussprechen, was Sie als Wahrheit erkennen, und Sie müssen bereit sein, diese Wahrheit aus Ihren eigenen Gründen zu verteidigen. Und dann müssen Sie die Tatsache akzeptieren, dass böswillige Menschen Sie beschuldigen, Ihre Wahrheit zu verteidigen oder sich mit anderen wegen deren Gründe in eine Reihe gestellt zu haben. Das ist das, was Meinungsfreiheit bedeutet – es ist sehr unbequem. Es bringt Sie manchmal mit den falschen Leuten ins Bett.“
Tony Judt gibt also zu, das Vokabular für eine antisemitische Verschwörungstheorie zu liefern, und verwahrt sich gleichzeitig gegen jegliche Kritik an seinem Verhalten. Er bekennt, dass er
„kaum umhin“ komme, zu sagen, dass es eine
„De-facto-Verschwörung, ein Komplott oder eine Zusammenarbeit gibt“, und das
„hört sich schrecklich an“, wie die
Protokolle der Weisen von Zion und die Verschwörungstheorie über die „zionistisch besetzte Regierung“. Er räumt ein, dass die antisemitischen Verschwörungstheoretiker im Grunde das Gleiche sagen wie er und seine Mitstreiter – aber aus angeblich verschiedenen Gründen. Judt scheut sich auch nicht, eine falsche Analogie zwischen seinem Verhalten und demjenigen Arthur Koestlers aus dem Jahr 1948 zu ziehen. Koestler wusste, dass der Gulag existierte und dass es eine Verantwortung gab, dies auszusprechen – auch dann, wenn man damit den Antikommunisten Recht gab, die ebenfalls laut sagten, dass es den Gulag gibt.
So denkt Judt also heute, dass eine jüdische Verschwörung
„de facto“ existiert und dass er die Verantwortung hat, dies zu sagen – sogar wenn Antisemiten, die ebenfalls denken, dass es eine jüdische Konspiration gibt, damit offensichtlich Recht gegeben wird. Der Unterschied zwischen Judts und Koestlers Ausführungen liegt jedoch auf der Hand: Der Gulag existierte. Eine jüdische Verschwörung hingegen, die genügend Kraft hat, die einzige Supermacht der Welt in einen Krieg gegen ihr eigenes Interesse zu ziehen und Kritiker Israels aus einer amerikanischen Akademie auszuschließen, gibt es nicht. Allerdings waren – das sei hier in Erinnerung gerufen – auch die McCarthyisten Verschwörungstheoretiker; sie behaupteten, Amerika sei unter den Einfluss einer Moskauer Konspiration geraten, die jeden liberalen Volksschullehrer und jeden „roten“ Hollywood-Schauspieler umfasse.
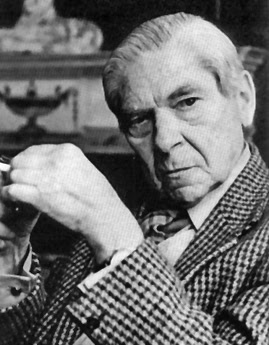
Koestler (Foto) glaubte nicht an eine Verschwörung – auch nicht an eine „de facto“ existierende –, nicht an ein „Komplott“ und nicht an eine „Zusammenarbeit“. Koestler war nicht wie Judt. Tatsächlich stammt der Antizionismus Judts (wiewohl nicht der Rest seiner Weltanschauung) von der politischen Tradition derjenigen ab, die zum Gulag geschwiegen haben, weil das Sprechen darüber den Imperialisten geholfen hätte. Es ist eine politische Tradition, die in der Gegenwart fortgesetzt wird, deren Anhänger Schweigen bewahren zu allen politischen Bewegungen oder Staaten, die eine antizionistische und antiimperialistische Rhetorik üben und die Menschenrechte grob verletzen. Die antistalinistische Linke sprach sich damals gegen den „gesunden linken Menschenverstand“ aus. Judt hingegen versäumt es, sich gegen den heutigen „linken“ Menschenverstand auszusprechen, der darauf besteht, dass sowohl Israel als auch die Juden, die Israel unterstützen, unvergleichlich böse und mächtig sind.
Der Wissenschaftler Judt argumentiert, dass der entscheidende Umstand, der ihn von den antisemitischen Idioten unterscheide, die Vernunft hinter seiner Analyse sei – auch wenn diese ansonsten im Grunde genommen die gleiche ist wie beispielsweise die von Duke. Für seine Behauptung, es existiere eine
„De-facto-Verschwörung“ (auch wenn
„sich das schrecklich anhört“), will Judt also ehrbare Motive haben. Der Antisemit Duke hingegen sei bloß bei dieser einen Gelegenheit quasi zufällig zur richtigen Konsequenz bezüglich der globalen Bedrohung durch die „jüdische Macht“ und deren Verantwortung für den Irak-Krieg gelangt. Judts Problem scheint zu sein, dass er entweder unfähig oder nicht willens ist, zu zeigen, wie das, was er glaubt, sich
grundsätzlich von dem unterscheidet, was antisemitische Idioten glauben.
Wie hatte er es noch gleich formuliert?
„Sie müssen aussprechen, was Sie als Wahrheit erkennen, und Sie müssen bereit sein, diese Wahrheit aus Ihren eigenen Gründen zu verteidigen. Und dann müssen Sie die Tatsache akzeptieren, dass böswillige Menschen Sie beschuldigen, Ihre Wahrheit zu verteidigen oder sich mit anderen wegen deren Gründe in eine Reihe gestellt zu haben. Das ist das, was Meinungsfreiheit bedeutet – es ist sehr unbequem. Es bringt Sie manchmal mit den falschen Leuten ins Bett.“ Natürlich soll man die Wahrheit sagen, sogar dann, wenn diese Wahrheit Zustimmung bei Leuten findet, mit denen man sonst nichts zu tun haben will. Nur lautet Judts Wahrheit, dass die amerikanische Politik von einer jüdischen Verschwörung dominiert wird. Er weiß, dass er sich damit in eine Reihe mit Rassisten, Neonazis und Antisemiten stellt, die aber im Gegensatz zu ihm nur aus bösem Willen an diese „Wahrheit“ glaubten. Dabei ist Judt voll des Selbstmitleids und beschuldigt seine Kritiker, sie handelten in unlauterer Absicht; er verlässt sich dabei auf ein Ad-hominem-Argument. Auf diese Weise stellt er die
persönliche Motivation in den Mittelpunkt seiner Verteidigung. Er ist ein guter Kerl, steht links und ist vom Bestreben nach Wahrheit und Gerechtigkeit (für die Palästinenser) motiviert. David Duke hingegen, der bei dieser Gelegenheit auf die „Wahrheit“ über die Israel-Lobby und deren angebliche Verantwortung für Krieg gestolpert ist, hat böse Hintergedanken.

Diejenigen, die nun fragen, weshalb sich Judt und Duke (Foto) im selben Bett einer antijüdischen Verschwörungstheorie befinden, täten das in böser Absicht, behauptet Judt. Diese böse Absicht sei zugleich diejenige der Israel-Lobby, die aus Verlogenheit die antisemitische Karte spiele und ihm deshalb vorwerfe, sich mit dem Antisemiten Duke in ein politisches Bett zu legen. Das Problem dabei bleibt gleichwohl, dass Tony Judt mit seiner Stellungnahme Antisemiten und Rassisten tatkräftige Hilfe leistet. Denn Judt ist ein respektierter Historiker, und er beeinflusst den Mainstream. Wäre er wirklich aufrichtig, dann hätte er zu sagen: „Sie müssen aussprechen, was Sie als Wahrheit erkennen, und Sie müssen bereit sein, diese Wahrheit aus Ihren eigenen Gründen zu verteidigen. Und dann müssen Sie die Tatsache akzeptieren, dass Sie damit den Rassismus und den Antisemitismus stärken.“
Doch wie sieht es mit der vorgeblichen Wahrheit des Tony Judt aus? Judt erklärt, die Israel-Lobby verneine als einzige unter den Lobbys ihre eigene Existenz und versuche, ihre Kritiker zum Schweigen zu bringen. Wäre er aufrichtig um die Wahrheit bemüht, dann müsste er konzedieren, dass auf der Website des AIPAC ausdrücklich benannt wird, um was für eine Organisation es sich handelt, und zwar schon im Namen
The American Israel Public Affairs Committee. Wenn eines der offensichtlichen Organe der Israel-Lobby dann auch noch auf ihrer Startseite unumwunden erklärt,
tatsächlich eine Israel-Lobby zu sein –
„America’s Pro-Israel Lobby“ nämlich –, dann ist
das die Wahrheit und nicht das, was Judt fabuliert. Wenn dann
Cambridge University Press, einer der prestigeträchtigsten Verlage Großbritanniens, ein bereits veröffentlichtes Buch zurückzieht, weil ein saudi-arabischer Milliardär es beanstandet hat, dann werden Judts Behauptungen über die Einzigartigkeit der Israel-Lobby und ihren Einfluss noch fragwürdiger – denn diese angeblich so mächtige Israel-Lobby war nicht in der Lage, das Buch von Mearsheimer und Walt zu verhindern.
Tony Judt könnte sich mit der Frage beschäftigen, warum man keine Pauschalurteile über „Rassen“ und „Völker“ verbreiten sollte. Und er könnte zu dem Schluss kommen, dass die Israel-Lobby selbst für den Fall, dass sie ihre Kritiker tatsächlich zum Schweigen bringen will, dazu nicht wirklich fähig ist – wie ja sein eigenes hohes Ansehen und seine häufigen öffentlichen Stellungnahmen sowie beispielsweise die Verbreitung der Arbeiten von Mearsheimer und Walt zeigen. Die Geschichte lehrt – und das sollte der an einer Universität tätige Professor Judt wissen –, dass der Einsatz von Stereotypen über die „unheilvolle jüdische Macht“ und über deren „geheimen Einfluss“ – von denen Judt behauptet, wahr zu sein – schon in der Vergangenheit weit verbreitet war, obwohl diese Stereotypen falsch waren. Und dieser Einsatz hat zu bis dahin unvorstellbaren Gräueln geführt. Dies zu sagen, hätte natürlich die rhetorische Kraft seiner These geschwächt, aber einige der schädlichen Folgen seiner Behauptungen über Juden und die Israel-Lobby – die ihm nicht willkommen sein können – gemildert.
Doch Judt bevorzugt es, darüber zu schweigen, dass das, was er als Wahrheit behauptet, den Rassismus und den Antisemitismus bestärkt; solche Konsequenzen sind für den sich zum Weltbürgertum bekennenden Intellektuellen offenbar unwichtig. Wenn hingegen seine Kritiker das aussprechen, was sie als Wahrheit erkennen, dann schweigt Judt keineswegs. Zu viele Menschen erhöben Beschuldigungen gegen diejenigen, die Israel feindlich gesinnt sind, findet Judt. Und das degradiere den Holocaust, vergrößere den Antisemitismus und unterminiere die Bedingungen, die das Leben in der amerikanischen Republik lebenswert machten. Folgt man Judt, dann stärken die Juden – er erwähnt explizit die
Anti-Defamation League (ADL) – also selbst den Antisemitismus, und sie bedrohen auch das Leben in den USA. Solche Ansichten sind sattsam bekannt, und Judt hat in der Tat Recht, wenn er denkt, dass er sich mit sehr unangenehmen Gefährten im Bett befindet.
In Wirklichkeit sagt er damit, dass seine Kritiker ihre eigenen Anschauungen zensieren sollen – den Hinweis auf Judts antisemitischen Bettgesellen eingeschlossen –, um nicht den Antisemitismus zu befördern. Wenn er hingegen selbst aufgefordert wird, seine Ansichten zu revidieren, damit der Judenhass nicht noch weiter wächst, empfindet er das als moralische Erpressung, als Zensur und als nicht zu tolerierende Attacke auf die kostbare akademische Freiheit. Damit entpuppt sich Tony Judt als jemand, der doppelte Standards anwendet. Zudem sagt er die Unwahrheit, wenn er behauptet, in den USA würden israelkritische Ansichten
tatsächlich unterdrückt. Die Ansichten von ihm selbst, Norman Finkelstein, Noam Chomsky, John Mearsheimer und Stephen Walt werden nicht nur gehört, sie lösen sogar breite öffentliche Diskussionen aus. Wenn Judt behauptet, die Thesen dieser Wissenschaftler würden zum Schweigen gebracht, dann hat er keine Ahnung davon, was es bedeutet, wenn jemand
wirklich wegen seiner politischen Ansichten mundtot gemacht wird. Als Historiker müsste er diesen Unterschied jedoch kennen.
Anmerkungen:
* Ich verwende dabei Gedankengänge von Eve Garrard, David Hirsh und Norman Geras.
(1) Herbert Müller-Guttenbrunner: Alphabet des anarchistischen Amateurs, Berlin 2007 (Matthes & Seitz), S. 193ff.
(2) Der frühere Ku-Klux-Klan-Anführer David Duke lebte von 2000 bis 2002 in Russland und in der Ukraine, wo er seine antisemitischen Theorien verbreitete. Im Dezember 2002 kehrte er zurück in die USA, wo er sich schuldig bekannte, während mehrerer Jahre, in denen er eine weiße Suprematie propagierte, seine Anhänger finanziell betrogen zu haben. Am 15. April 2003 trat er eine fünfzehnmonatige Haftstrafe an. Seit seiner Entlassung setzt er seine antisemitische Tätigkeit fort. Duke zollte Mearsheimer und Walt Anerkennung und behauptete, deren Arbeit bestätige viele seiner Behauptungen. Von einer obskuren ukrainischen Akademie erhielt er einen Doktortitel. Duke hielt zudem eine Ansprache auf der Teheraner Konferenz der Holocaustleugner im Dezember 2006 und wiederholte dort seine Thesen über den Zionismus und andere Themen; die in Europa wegen Holocaustleugnung inhaftierten Personen sind für ihn „Gelehrte und Forscher“.
(3) Norman G. Finkelstein ist ein amerikanischer Politologe, dessen Arbeitsvertrag 2007 von der katholischen DePaul-University in Chicago nicht verlängert wurde. Finkelstein griff in der Folge einige seiner Kollegen an der Universität physisch an. In seiner bescheidenen Art erklärte er zu seinen Kämpfen um seinen Posten: „Ich werde während der letzten paar Wochen als Märtyrer besetzt“ und „Vor 2000 Jahren hat das ein anderer Jude mit gemischten Ergebnissen versucht“. Mit Finkelstein erhält die bei Antisemiten beliebte These akademische Weihen, Holocaust-Überlebende und jüdische Eliten machten mit der Erinnerung an die Vernichtung der europäischen Juden ein großes Geschäft. Zudem sei es ja ein jüdischer Akademiker, der dies nun behaupte. So kann die These von der „Holocaust-Industrie“ auch im Medien-Mainstream reüssieren. Dadurch bestärkt, macht sich die extreme Rechte weitere Hoffnungen, preist Finkelstein als „jüdischen David Irving“, und wenn sie auch vergeblich darauf warten wird, dass Finkelstein zur Holocaustleugnung übergeht, so kann sie doch erfreut beobachten, wie die Erinnerung an die Shoa weiter abgewehrt wird. Finkelsteins Bücher über die „Holocaust-Industrie“ waren Bestseller in Deutschland und Österreich.
(4) Arthur Koestler (geboren 1905 in Ungarn, gestorben 1983 in England) war ein britischer Schriftsteller und Journalist, der 1940 mit seinem in 30 Sprachen übersetzten Roman Sonnenfinsternis schlagartig bekannt wurde. Darin schilderte er die Geschichte eines alten Bolschewisten, der dazu gebracht wird, Verbrechen zu gestehen, die er nie begangen hat. Koestler rechnete in seinem Buch mit den Praktiken der Kommunistischen Partei ab. Er studierte an der Universität Wien, ging aber 1926 als überzeugter Zionist nach Palästina. Nach kurzem Aufenthalt in einem Kibbuz wurde er Korrespondent des Ullstein-Verlags im Nahen Osten. Er wurde wie viele andere Intellektuelle Mitglied der KPD. Während des Bürgerkriegs in Spanien arbeitete er als Korrespondent der britischen Tageszeitung News Chronicle und wurde von Faschisten gefangen genommen. Koestler, der ab 1940 in englischer Sprache schrieb, wurde 1948 britischer Staatsbürger. Er schrieb auch populärwissenschaftliche Bücher, darunter auch ein sehr umstrittenes über die Ursprünge des jüdischen Volkes. Später erkrankte er an Leukämie und an der Parkinsonschen Krankheit und beging als Anhänger der selbstbestimmten Euthanasie mit seiner Frau Cynthia Selbstmord.
 Das Berliner Ensemble wird ab dem 11. Februar an drei aufeinander folgenden Abenden Bertolt Brechts Stück Mutter Courage und ihre Kinder bei einem Theaterfestival im Iran aufführen. Der Intendant der Hauptstadtbühne, Claus Peymann, will dieses Unternehmen als Zeichen gegen die vermeintlichen Kriegspläne der USA verstanden wissen: „Man sollte Teheran besuchen, bevor es zerbombt ist.“ Etwa 50 Demonstranten protestierten am vergangenen Samstag gegen das anstehende Gastspiel bei den Mullahs: Sie verteilten Flugblätter im Theater am Schiffbauerdamm, der Spielstätte des Ensembles.
Das Berliner Ensemble wird ab dem 11. Februar an drei aufeinander folgenden Abenden Bertolt Brechts Stück Mutter Courage und ihre Kinder bei einem Theaterfestival im Iran aufführen. Der Intendant der Hauptstadtbühne, Claus Peymann, will dieses Unternehmen als Zeichen gegen die vermeintlichen Kriegspläne der USA verstanden wissen: „Man sollte Teheran besuchen, bevor es zerbombt ist.“ Etwa 50 Demonstranten protestierten am vergangenen Samstag gegen das anstehende Gastspiel bei den Mullahs: Sie verteilten Flugblätter im Theater am Schiffbauerdamm, der Spielstätte des Ensembles. Bündnis gegen Appeasement (Berlin)
Bündnis gegen Appeasement (Berlin)