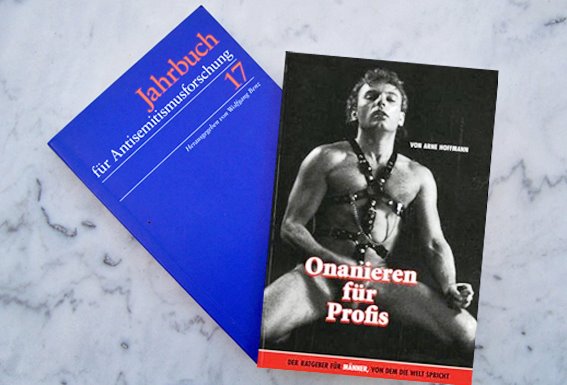Traumatherapie

Die „Mutter aller Niederlagen“ war es für Oliver Kahn, andere sprachen vom „Trauma von Barcelona“ oder gar vom „Sekundentod“. Zehn Jahre ist es jetzt her, dieses Champions League-Finale der Bayern gegen Manchester United, das der von mir seit meiner Kindheit verehrte Klub eigentlich schon gewonnen hatte – wären da nicht diese vermaledeiten hundertzwei Sekunden in der Nachspielzeit gewesen, diese gottverdammten Nicht-mal-zwei-Minuten, in denen United aus einem 0:1 ein 2:1 machte. Noch heute finde ich es unfassbar, unglaublich, unbegreiflich, was damals geschehen ist – in etwa so, als wäre ein Naturgesetz aufgehoben worden, als hätte jemand bewiesen, dass es gar keine Schwerkraft gibt oder dass die Erde doch eine Scheibe ist. Und das nicht deshalb, weil es nicht vorstellbar wäre, dass die Bayern ein internationales Endspiel verlieren (das war ihnen schließlich schon 1982 und 1987 passiert). Sondern weil ich es schlicht ausgeschlossen hätte, dass eine Mannschaft, die nach 90 Minuten einsnull führt (und dem zweiten Tor wesentlich näher ist als der Gegner dem Ausgleich), keine zwei Minuten später geschlagen vom Platz gehen muss. Und es war ja auch nicht irgendeine Mannschaft, sondern es waren die Bayern. Meine Bayern.
Souverän schwebten sie seinerzeit durch alle Wettbewerbe: durch die Meisterschaft, den Pokal und eben die Champions League. Ein großes Team mit einem großen Trainer. Nun sollte die Saison ihr Sahnehäubchen bekommen. Und es sah gut aus, sehr gut sogar: Baslers frühes Tor im Camp Nou, haufenweise feine Torchancen, den Kick komplett unter Kontrolle – nichts, aber auch wirklich gar nichts deutete darauf hin, dass Manchester die Partie noch drehen können würde. Als die Nachspielzeit angezeigt wurde, überkam mich vor dem Fernseher zwar ein leichtes Unbehagen, aber ein eher unspezifisches, eines, das ich bei einer knappen Führung kurz vor Schluss immer habe, und jedenfalls keines, das Ausdruck einer konkreten Vorahnung gewesen wäre. Zu selbstbewusst waren die Bayern aufgetreten, zu sicher, um das Spiel noch herzuschenken. Und dann kam Sheringham. Und dann Solskjær. Und dann die allumfassende, dröhnende, lähmende Leere.
Acht Monate vor diesem grausamen Abend hatte ein gewisser Johannes Keller in der taz eine Suada gegen die Bayernfans veröffentlicht, die in der Behauptung gipfelte: „Bayern-Anhänger sind keine Fußballfans, sondern Feiglinge, unfähig zu wahrer Hingabe, die das Risiko einschließt, tief enttäuscht zu werden.“ Es hätte nicht erst der Ereignisse von Barcelona bedurft, um den Mann als Kretin zu entlarven, als Lügner und Neidbeißer, dem jeder Gedanke an das Glück fremd ist, weil er keine Erfüllung kennt. Aber Barcelona hat den naseweisen, nassforschen Bescheidwisser – und mit ihm die Millionen anderer Bayernhasser – noch einmal besonders gründlich und nachdrücklich widerlegt, wobei ich auf diese Form der Beweisführung liebend gerne verzichtet hätte. Leider gibt es die Kellers dieser Welt nicht nur in einer rotgrünen Tageszeitung, die man ignorieren kann, sondern sie treiben sich gelegentlich auch im eigenen, sagen wir, Umfeld herum. An jenem 26. Mai 1999 weideten sie sich an der Niederlage der verhassten Bayern wie an keiner zuvor; ihr bestimmendes Gefühl war ein sehr deutsches: Schadenfreude.
Und so klingelte, kaum dass mich Schiedsrichter Pierluigi Collina mit seinem Schlusspfiff in eine Mischung aus Verzweiflung, Ohnmacht, Trauer und Apathie gestürzt hatte, in meiner damaligen Wohngemeinschaft nahezu unaufhörlich das Telefon. Bei den ersten drei Anrufern übergab mir mein Mitbewohner noch den Hörer, die folgenden zwölf wimmelte er auf meinen Wunsch hin ab, notierte aber die Namen und das jeweilige Anliegen. Exakt einer dieser fünfzehn Mitteilungsbedürftigen hatte so etwas wie Trost im Sinn, der Rest nichts als Häme, Hohn und Spott – wobei das Triumphgeheul oft genug auch noch als penetranter Ausweis politisch korrekter Gesinnung daherkam, das heißt als ressentimentgeladenes Geschwätz von der gerechten Niederlage der „Geldsäcke“, der „arroganten Dusel-Bayern“, der „Scheiß-Millionäre“ etc. pp. (Einige entschuldigten sich später: Sie hätten ja nicht geahnt, dass mir „das“ „so nahe geht“, und sich gewundert, dass ich „als Bayernfan überhaupt zu solchen Emotionen in der Lage“ sei. Hätte nur noch gefehlt, dass jemand „Ist doch bloß Fußball“ sagt.)
Zwei Jahre danach ehelichte die Mutter aller Niederlagen mit dem Segen des Fußballgottes den Vater aller Siege, und da wusste ich, wozu die Seelenmarter gut gewesen war. Als Sergej Barbarez den HSV in der 90. Minute jenes letzten Bundesligaspieltags der Saison 2000/01 in Führung schoss, schien es noch, als hätte der himmlische Gebieter über das Runde seinen sadistischen Spaß daran, die Bayern samt ihrem Anhang erneut brutalstmöglich zu quälen. Aber in Wahrheit hatte er sich mit den Schalkern sein nächstes Opfer auserkoren und zwecks Vollstreckung des göttlichen Willens seinen irdischen Vertreter Patrik Andersson entsandt – das Ganze, natürlich, in der Nachspielzeit, wie schon eine Woche zuvor. Vier Tage später, im Champions-League-Finale gegen den FC Valencia in Mailand, delegierte er diese Aufgabe an Oliver Kahn. Das nennt man dann wohl eine überirdische Traumatherapie.
Den Zettel mit den Namen der Anrufer in der Horrornacht von Barcelona hatte ich mir zwischenzeitlich übrigens gut aufbewahrt. Jetzt, nach der Triumphnacht von Milano, brauchte ich ihn noch einmal, nämlich für genau vierzehn Telefonate: meine irdische Traumatherapie.