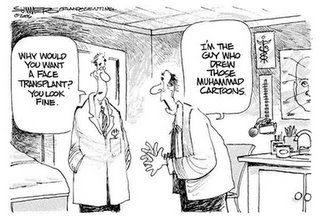Rhythm n’ Jihad
 Bisweilen bekommt das arg strapazierte Bild vom Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, frische Farbe. Mohammed Kamel Mostafa (Foto, rechts) jedenfalls ist so ein Früchtchen, das gerade seine volle Blüte entfaltet und zum Sprung vom Baum ansetzt. Der 24-jährige ist der Sohn von Abu Hamza al-Masri (links), Imam der Finsbury Park Moschee im Norden Londons und kürzlich von einem Londoner Gericht wegen Anstiftung zum Rassenhass und Aufrufs zum Mord an Juden und Christen zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.
Bisweilen bekommt das arg strapazierte Bild vom Apfel, der nicht weit vom Stamm fällt, frische Farbe. Mohammed Kamel Mostafa (Foto, rechts) jedenfalls ist so ein Früchtchen, das gerade seine volle Blüte entfaltet und zum Sprung vom Baum ansetzt. Der 24-jährige ist der Sohn von Abu Hamza al-Masri (links), Imam der Finsbury Park Moschee im Norden Londons und kürzlich von einem Londoner Gericht wegen Anstiftung zum Rassenhass und Aufrufs zum Mord an Juden und Christen zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt.Sein Zögling jedoch gedeiht in seinem Sinne und stellt sich beim Jihad-Marketing zudem ein bisschen geschickter an als der Vater. Wozu in den Knast wandern, wenn man mit Aufrufen zum Heiligen Krieg gegen die Ungläubigen ganz legal viel Geld verdienen kann und darüber hinaus vielleicht sogar noch im Diesseits ein paar Jungfrauen abkriegt? Dazu muss man sich zwar auf die Mechanismen der verhassten westlichen Kulturindustrie einlassen, aber das ist ja alles nur zum Schein und für einen guten Zweck – der Allmächtige wird schon Gnade walten lassen, wenn der Feind nötigenfalls mit seinen eigenen Waffen geschlagen werden kann.
Also verdingt sich Mohammed Kamel Mostafa als Rapper und untermalt sein Anliegen mit mondänen Rhythmen. Letztes Jahr ließ sich das Unternehmen auch gleich recht viel versprechend an, als er das Duo Lionz Of Da Dezert mitbegründete und unter dem Bühnennamen Al-Ansary (der Löwe) beispielsweise auf dem ersten Oxford Muslim Music Festival im Juni 2005 mit „Allahu“, „There is no deity but God“ und einem dem Propheten gewidmeten Song seine Zielgruppe – „junge, im Westen aufgewachsene Muslime“ – zum Steppen brachte. Inzwischen strebt MC Hamza, wie ihn seine Fans tauften, eine Solokarriere an und zeigte sich in einem heute veröffentlichten Interview mit Undercover-Reportern der britischen Tageszeitung The Sun ausgesprochen optimistisch:
„Ich glaube, ich kann damit locker eine Million Pfund machen. Eine Million ist nichts. Ich habe mich bisher auf große Auftritte konzentriert, aber da draußen gibt es einen großen Markt, glaubt mir. 5.000 Leute kamen nach Wembley, um mich zu sehen.“
 Und um Lieder zu hören, die gewiss das Zeug zum Evergreen haben. In einem etwa textet Mostafa: „Ich wurde als Soldat geboren, Kalaschnikow über meiner Schulter, Frieden der Hamas und Hisbollah, das ist Allahs Weg ... Ich verteidige meine Religion mit dem Heiligen Schwert.“ Ein anderer Song ist seinen islamischen Brüdern gewidmet, die geschworen haben, für Allah zu sterben. Gut möglich also, dass der Hassrapper Recht behält, wenn er verspricht, dass seine Musik „im ganzen Nahen Osten populär werden wird – von Ägypten bis nach Palästina“. Ausgefeilte Pläne dafür hat er auch schon:
Und um Lieder zu hören, die gewiss das Zeug zum Evergreen haben. In einem etwa textet Mostafa: „Ich wurde als Soldat geboren, Kalaschnikow über meiner Schulter, Frieden der Hamas und Hisbollah, das ist Allahs Weg ... Ich verteidige meine Religion mit dem Heiligen Schwert.“ Ein anderer Song ist seinen islamischen Brüdern gewidmet, die geschworen haben, für Allah zu sterben. Gut möglich also, dass der Hassrapper Recht behält, wenn er verspricht, dass seine Musik „im ganzen Nahen Osten populär werden wird – von Ägypten bis nach Palästina“. Ausgefeilte Pläne dafür hat er auch schon:„Ich will ein Album für den Mainsteam herausbringen – und dann eine CD mit richtig harten Texten. Mein Ziel ist es, drei verschiedene Platten aufzunehmen: eine islamische, eine nahöstliche und eine mit Hip-Hop. Ich kann drei verschieden Märkte bedienen, in Asien singen wie auch auf Türkisch, Arabisch und Englisch.“Ein Video, das in der arabischen Welt gezeigt werden soll, ist ebenfalls in der Mache. Bis zur Million dauert es zwar vermutlich noch ein bisschen, aber der Anfang ist schon mal gemacht: Die Sun berichtet, Mostafa habe mit Werbeartikeln bereits mehrere hundert Pfund verdient und bekomme zudem monatlich etwa 200 Pfund aus steuerfinanzierten staatlichen Zuwendungen. Zudem seien ihm 150.000 Pfund aus dem Verkauf der Wohnung seines inhaftierten Vaters geblieben.
Ein guter Grundstock, um dereinst auch über die Sängerkarriere hinaus weisende Vorhaben in die Tat umzusetzen. Von den Sun-Journalisten gefragt, ob er hoffe, einmal so berühmt zu werden wie Osama bin Laden, antwortete Mostafa nämlich: „Inschallah!“ Und ergänzte:
„Hubschrauber, Panzer, Flugzeuge – ich kann sie fliegen und fahren. In mir ist eine Menge Wut. Aber ich habe keine Angst. Der Jihad ist eine klare Sache; du bekämpfst die, die dich bekämpfen – Moslem oder Nicht-Moslem.“Auch in punkto Bombenbau scheint der junge Mann Qualitäten zu haben: „Wenn ich an einem Ort festsitze, dem ich aber unbedingt entkommen will, kann ich schon was drehen aus Zucker und anderem Zeug.“ Das wird er wohl von seinem Familienoberhaupt gelernt haben: Bei einer Razzia in der Moschee, in der Abu Hamza al-Masri seine Hetzpredigten hielt, stellte die britische Polizei bereits im Januar 2003 neben Gasmasken, Schutzanzügen vor ABC-Angriffen und Blanko-Pässen auch haufenweise Waffen sicher.
Mohammed Kamel Mostafas Vater wird wegen der Form seiner Prothese in Großbritannien Hook genannt. Sein Ältester verfährt nun nach dem Motto: Früh krümmt sich, was ein Häkchen werden will. Bleibt zu hoffen, dass ihm wenigstens die Mechanismen des Marktes einen dicken Strich durch die Rechnung machen. Auf gute Musik müssen seine Glaubensbrüder dennoch nicht verzichten. Schließlich gibt es die Muslim Rave Party Sensation – coole Grooves zu einem noch viel stylisheren Video. Boxen an!
Übersetzung der Passagen aus der Sun: Liza