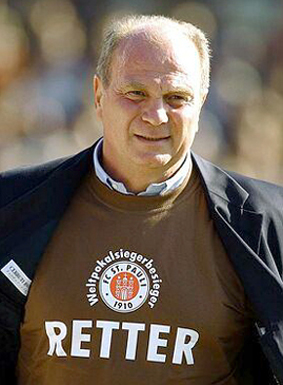Aus der Propagandaschleuder
 Ach, ist das schön, dass es das frühere FDJ-Blatt junge Welt noch gibt, die tägliche Pflichtlektüre für den griesgrämigen Zoni und den schlecht gelaunten Westlinken. Denn die Presselandschaft litte fraglos derben Mangel, sollte die Propagandaschleuder aus der Berliner Karl-Liebknecht-Straße dereinst vom Schlitten steigen und ihre Leser- wie Belegschaft dem Klassenfeind überantworten müssen – der mediale Globus wäre jedenfalls um eine echte Rarität ärmer. Doch einstweilen wehrt sich die Postille noch wacker gegen ihren Untergang, und abgesehen davon, dass man so viel kindlichem Trotz fast schon wieder mit einer gewissen Anerkennung begegnen möchte, ist es vor allem der sprichwörtliche Bierernst, mit dem in dieser Zeitung so überholte wie widerlegte Dogmen immer wieder aufgesagt werden, der sich ein ums andere Mal ungewollt in sein genaues Gegenteil verkehrt und so selbst scheinbar sachliche Darstellungen zur nachgerade humorigen Groteske mutieren lässt.
Ach, ist das schön, dass es das frühere FDJ-Blatt junge Welt noch gibt, die tägliche Pflichtlektüre für den griesgrämigen Zoni und den schlecht gelaunten Westlinken. Denn die Presselandschaft litte fraglos derben Mangel, sollte die Propagandaschleuder aus der Berliner Karl-Liebknecht-Straße dereinst vom Schlitten steigen und ihre Leser- wie Belegschaft dem Klassenfeind überantworten müssen – der mediale Globus wäre jedenfalls um eine echte Rarität ärmer. Doch einstweilen wehrt sich die Postille noch wacker gegen ihren Untergang, und abgesehen davon, dass man so viel kindlichem Trotz fast schon wieder mit einer gewissen Anerkennung begegnen möchte, ist es vor allem der sprichwörtliche Bierernst, mit dem in dieser Zeitung so überholte wie widerlegte Dogmen immer wieder aufgesagt werden, der sich ein ums andere Mal ungewollt in sein genaues Gegenteil verkehrt und so selbst scheinbar sachliche Darstellungen zur nachgerade humorigen Groteske mutieren lässt.Jüngstes Beispiel ist die heutige Titelstory, verfasst von Rüdiger Göbel, einem der beißwütigsten Kettenhunde des deutschen Antiimperialismus. „Frei nach dem Motto der US-Friedensbewegung ‚Nicht in unserem Namen’ haben Zehntausende Palästinenser gegen die Nahostkonferenz von Annapolis demonstriert“, weist er bereits zu Beginn seines Leitartikels die engagiertesten und entschlossensten Judenhasser als fromme Lämmchen aus, die zugleich jedoch ein Hauch von Seattle und Heiligendamm umweht: „Während die Proteste am Dienstag im Gazastreifen von der regierenden Hamas unterstützt wurden, gingen im Westjordanland bewaffnete Fatah-Milizen gegen Gipfelgegner vor.“ Die Gegenüberstellung zwischen (legitimer) „Regierung“ und (illegitimen) „Milizen“ ist dabei natürlich kein Zufall, denn die Nationalbolschewiken unterstützen selbstverständlich die Mörderbande Hamas, für sie das zarte Pflänzchen genuiner Volksherrschaft inmitten des ganzen fremdbestimmten Unkrauts.
„Die Entscheidungen, die in Annapolis getroffen werden, sind für das palästinensische Volk nicht bindend“, zitiert Göbel denn auch einen Hamas-Sprecher, um ihm sogleich zärtlich mit einem „Wie auch?“ unter die Arme zu greifen. Denn wenn die Masse es so will, ist selbst der Islamofaschismus lupenreinste Demokratie und daher entschiedene Empörung angesagt: „Obwohl die Hamas bei den letzten regulären Wahlen in den palästinensischen Gebieten die absolute Mehrheit der Stimmen erzielt hatte, war sie nicht in die USA eingeladen worden.“ Das wollte sie zwar nachweislich auch gar nicht, aber was soll man sich groß mit solchen Nebensächlichkeiten aufhalten, wenn der Ruf „Plenum!“ ohnehin viel lieblicher klingt: „Und so hatte die Organisation am Montagabend in Gaza kurzerhand eine ‚Gegenkonferenz’ veranstaltet, um auf ‚Gefahren einer Normalisierung der Beziehungen zu Israel’ hinzuweisen.“ Wie sich dieser „Hinweis“ konkret anhörte, dokumentiert Göbel – vermutlich bloß aus Platzgründen – nicht, deshalb sei der Wortlaut hier auszugsweise nachgereicht: Annapolis sei für die Palästinenser „eine zweite Nakba“, ließ die Hamas verlautbaren, George W. Bush ein „Kreuzzügler“ und „Zionist“ und „ganz Palästina muslimisch“. Schließlich gelte: „Das Recht auf Rückkehr nach Haifa, Jaffa und Jerusalem ist nicht verhandelbar“.
Alsdann kommen auch noch die Mullahs ins Spiel – mit einer Idee, die Göbel höchst attraktiv findet und entsprechend zu verpacken weiß: „Iran lud am Dienstag Interessierte für die kommenden Tage zu einem alternativen Nahostgipfel ein“, schreibt er. Was auf solchen „alternativen Gipfeln“ verhandelt wird, weiß man nicht erst seit der Holocaustleugner-Konferenz in Teheran vor knapp einem Jahr – und diesmal wird es zweifellos nicht anders sein, wie der junge Welt-Redakteur per ausführlichem Zitat bestätigt: „Vertreter aller palästinensischen Organisationen, ‚die für die Befreiung ihres Landes kämpfen’, würden in dieser oder der kommenden Woche erwartet, sagte Regierungssprecher Gholamhossein Elham in der iranischen Hauptstadt. ‚Annapolis repräsentiert nicht die Palästinenser und läuft ihren Rechten zuwider.’ Israel habe als Besatzungsmacht in den palästinensischen Gebieten ‚Verbrechen gegen die Menschlichkeit’ zu verantworten und besitze daher keine Legitimität.“ „Befreiung ihres Landes“ ist halt schlicht ein Synonym für Judenvernichtung.
Zum Schluss folgt noch ein aufmunternder Ruf nach ganz drüben: Ihr seid nicht alleine! „Es blieb Nichtregierungsorganisationen vorbehalten, auf die ‚humanitäre und politische Krise’ im Gazastreifen aufmerksam zu machen“, lobt Rüdiger Göbel die kämpfende Basis: „40 internationale, israelische und palästinensische Gruppen forderten zum Gipfelbeginn ein sofortiges Ende der israelischen Blockade und ein Ende der internationalen Isolation.“ In dem dazugehörigen Aufruf werden die obligatorischen Mythen verbreitet, inklusive der Klagen über die „stetigen Verschlechterungen in den Bereichen Bildung, medizinische Versorgung, Beschäftigung und Wirtschaft“; der Gazastreifen sei nämlich ein einziges großes Gefängnis für 1,5 Millionen Palästinenser, die „ein Leben ohne überlebensnotwendige Mittel und ohne Entwicklungsmöglichkeiten“ führten. Schuld daran ist – natürlich – Israel, das sich zwar aus Gaza zurückgezogen hat, aber dennoch für alles verantwortlich sein soll, was dort passiert; das den Raketenbeschuss genauso gleichmütig ertragen soll wie die Vernichtungsdrohungen; das die Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten versorgen soll, obwohl die Hamas entsprechende Lieferungen immer wieder zurückweist, und das die Grenzkontrollen abschaffen möge, obwohl vollkommen klar ist, wozu die Hamas das nutzen wird.
Aber Dogma ist Dogma – in der palästinensischen wie in der jungen Welt –, und daher darf und soll sich nichts ändern, selbst wenn alles in Scherben fällt. Eine gute Nachricht aus Annapolis gab es dabei sogar für Göbel und die Seinen: Mahmud Abbas hat bereits angekündigt, eventuelle Verhandlungsergebnisse mit Israel in einem Referendum zur Abstimmung zu stellen. Da wird die Propagandaschleuder wieder auf Hochtouren laufen, bevor sie dann irgendwann vielleicht doch über den Jordan geht.