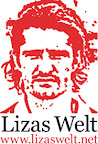Gallowaygate
 Einmal angenommen, George Galloway wäre nicht in Großbritannien, sondern in Deutschland als Politiker aktiv: Man fände ihn vermutlich bei der Linkspartei. Dort würde er zweifellos vor allem versuchen, den Schmusekurs von Epigonen wie Oskar Lafontaine und Norman Paech mit der Hizbollah und der Hamas zu einer handfesten Beziehung auszubauen; zudem fände er die Statements der Linken zum jüdischen Staat ohne Frage viel zu lau: Wozu, wie Paech, Israel nur als „verbale Überhöhung“ bezeichnen, wenn man eigentlich „Terroristenstaat“ sagen will? Und auch die Aktivitäten gegen den Irakkrieg wären Galloway (Foto) wohl nicht handfest genug gewesen: Weshalb mit Parteigeldern kleckern, wo es sich mit Saddam Husseins Reichtümern doch ordentlich klotzen lässt? Letzteres beschert Galloway in Großbritannien nun allerdings Ärger, genauer gesagt einen einmonatigen Ausschluss aus dem Parlament, dessen Mitglied er für die Respect-Partei ist. Die Strafe wird voraussichtlich diese Woche verhängt werden. Der Grund für sie sind Galloways Aktivitäten für die 1998 von ihm gegründete Organisation Mariam Appeal (Aufruf für Mariam), deren Gelder zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem Verkauf irakischen Öls unter Saddam Hussein im Rahmen des 1995 begonnenen UN-Programms Oil for Food stammten.
Einmal angenommen, George Galloway wäre nicht in Großbritannien, sondern in Deutschland als Politiker aktiv: Man fände ihn vermutlich bei der Linkspartei. Dort würde er zweifellos vor allem versuchen, den Schmusekurs von Epigonen wie Oskar Lafontaine und Norman Paech mit der Hizbollah und der Hamas zu einer handfesten Beziehung auszubauen; zudem fände er die Statements der Linken zum jüdischen Staat ohne Frage viel zu lau: Wozu, wie Paech, Israel nur als „verbale Überhöhung“ bezeichnen, wenn man eigentlich „Terroristenstaat“ sagen will? Und auch die Aktivitäten gegen den Irakkrieg wären Galloway (Foto) wohl nicht handfest genug gewesen: Weshalb mit Parteigeldern kleckern, wo es sich mit Saddam Husseins Reichtümern doch ordentlich klotzen lässt? Letzteres beschert Galloway in Großbritannien nun allerdings Ärger, genauer gesagt einen einmonatigen Ausschluss aus dem Parlament, dessen Mitglied er für die Respect-Partei ist. Die Strafe wird voraussichtlich diese Woche verhängt werden. Der Grund für sie sind Galloways Aktivitäten für die 1998 von ihm gegründete Organisation Mariam Appeal (Aufruf für Mariam), deren Gelder zu einem nicht unerheblichen Teil aus dem Verkauf irakischen Öls unter Saddam Hussein im Rahmen des 1995 begonnenen UN-Programms Oil for Food stammten.Die ursprüngliche Idee dieses Programms bestand darin, „den Irak kontrolliert Öl verkaufen zu lassen, mit dessen Erlös über ein UN-Treuhandkonto Nahrungsmittel und Medizin für die leidende irakische Bevölkerung importiert werden sollten“, schrieben Thomas von der Osten-Sacken und Thomas Uwer 2004. „Auf diese Weise sollte den Irakern geholfen und das Regime daran gehindert werden, Waffen und Dual-Use-Güter zu beschaffen. Möglichst große Transparenz bei den irakischen Ankäufen und bei seinem Finanzgebaren sollten ebenfalls gewährleistet werden. [...] Die UN stellten es dem irakischen Diktator allerdings nicht nur frei, selbst die Firmen auszusuchen, die mit dem Einkauf von Gütern beauftragt wurden, sondern sie sorgten auch für Diskretion bei der Abwicklung, indem sie die Namen dieser Firmen geheim hielten.“ Die Korruption blühte zwangsläufig; das „Kofigate“ nutzte nicht zuletzt dem irakischen Baath-Regime, wie von der Osten-Sacken und Uwer schilderten: „Der Trick, den Saddam nutzte, um an die Milliarden zu kommen, bestand in erster Stelle darin, Ölgutscheine weit unter Marktpreis für importierte Güter und andere Dienstleistungen auszugeben, die die Empfänger dann zum bis zu 30% höheren Weltmarktpreis einlösen konnten. Einen Teil des Geldes behielt der Empfänger, der andere wurde auf schwarze Konten rücküberwiesen. Hinzu kommt, dass Saddams Vertragsfirmen fantastische Preise für die von ihnen gelieferten Waren verlangten. Die Hälfte des Surplus’, der zwischen 10 und 100% des Marktpreises betrug, strich ebenfalls der irakische Staat ein. Ölgutscheine wurden auch direkt als Schmiergelder für Saddam wohlgesonnene Personen und Institutionen verwendet.“ Ende 2003 wurde das Oil for Food-Programm eingestellt.
1998 gründete George Galloway den Mariam Appeal, dessen offizielles Ziel es war, „das irakische Volk mit medizinischer Ausstattung und medizinischer Hilfe zu versorgen, die Ursachen und Folgen der Krebsepidemie im Irak zu beleuchten und die medizinische Behandlung irakischer Kinder außerhalb des Iraks zu arrangieren“. Im Mittelpunkt standen dabei die Aktivitäten für die vierjährige, an Leukämie erkrankte Mariam Hamza, die in Großbritannien gepflegt werden sollte. Das Mädchen war von Galloway und den anderen Initiatoren der Vereinigung nicht zuletzt deshalb ausgewählt worden, weil sein Leiden eine Folge der UN-Sanktionen und des Gebrauchs von mit Uran angereicherten Waffen durch die Alliierten im Golfkrieg 1991 gewesen sein soll. Das Kind musste also als Propagandaobjekt herhalten. Galloway ließ seinen Mariam Appeal denn auch nicht offiziell als Wohltätigkeitsorganisation registrieren und versuchte, sich so den behördlichen Bestimmungen zu entziehen, die unter anderem Rechenschaftsberichte und Kontoprüfungen vorsehen und den Wohlfahrtsverbänden politische Werbung untersagen.
 Der damals noch der Labour-Partei zugehörige Parlamentarier taxierte die Kosten für die Behandlung Mariam Hamzas auf rund 50.000 Britische Pfund und startete umfangreiche Spendenaufrufe. Im April 2003 berichtete der Daily Telegraph, dass die Vereinigung bereits mehr als 800.000 Pfund für die Organisation ihrer Kampagne ausgegeben habe – darunter 18.000 Pfund für Galloways Frau Amineh Abu-Zayyad –, während die Mariam zugesagten monatlichen 65 Pfund für Nahrungsmittel und Reisekosten seit längerem nicht gezahlt worden seien. Zunehmend kritische Fragen bügelte Galloway mit dem Hinweis ab, seine Unternehmung sei nie eine Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern immer schon ein politisches Projekt gewesen. Dennoch gebe es keinen Missbrauch der Spendengelder; außerdem es sei nichts Ungewöhnliches, dass die Mitarbeiter von Vereinigungen wie seiner bezahlt werden. Aus den Zuwendungen finanzierte sich Galloway unter anderem zahlreiche Auslandsreisen, darunter in Länder wie Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Libanon und den Irak. Die britische Charity Commission drängte auf eine Registrierung des Mariam Appeal als Wohltätigkeitsorganisation und auf einen Einblick in die Bücher der Vereinigung. Doch Galloway bedauerte: Die Unterlagen seien nicht mehr in seinen Händen, sondern befänden sich seit 2001 in Amman und Bagdad.
Der damals noch der Labour-Partei zugehörige Parlamentarier taxierte die Kosten für die Behandlung Mariam Hamzas auf rund 50.000 Britische Pfund und startete umfangreiche Spendenaufrufe. Im April 2003 berichtete der Daily Telegraph, dass die Vereinigung bereits mehr als 800.000 Pfund für die Organisation ihrer Kampagne ausgegeben habe – darunter 18.000 Pfund für Galloways Frau Amineh Abu-Zayyad –, während die Mariam zugesagten monatlichen 65 Pfund für Nahrungsmittel und Reisekosten seit längerem nicht gezahlt worden seien. Zunehmend kritische Fragen bügelte Galloway mit dem Hinweis ab, seine Unternehmung sei nie eine Wohltätigkeitsveranstaltung, sondern immer schon ein politisches Projekt gewesen. Dennoch gebe es keinen Missbrauch der Spendengelder; außerdem es sei nichts Ungewöhnliches, dass die Mitarbeiter von Vereinigungen wie seiner bezahlt werden. Aus den Zuwendungen finanzierte sich Galloway unter anderem zahlreiche Auslandsreisen, darunter in Länder wie Jordanien, die Vereinigten Arabischen Emirate, den Libanon und den Irak. Die britische Charity Commission drängte auf eine Registrierung des Mariam Appeal als Wohltätigkeitsorganisation und auf einen Einblick in die Bücher der Vereinigung. Doch Galloway bedauerte: Die Unterlagen seien nicht mehr in seinen Händen, sondern befänden sich seit 2001 in Amman und Bagdad.Dort war seit jenem Jahr Fawaz Zuriekat maßgeblich für die gesamte Organisation verantwortlich. Zuriekat, ein jordanischer Geschäftsmann, machte insgesamt etwa 450.000 Pfund für sie locker – knapp 380.000 Pfund davon stammten aus dem Verkauf irakischen Öls im Zuge des Oil for Food-Programms, wie die Charity Commission ermittelte. Auch eine Untersuchung des amerikanischen Senats kam zu dem Ergebnis, dass Galloway über den Mariam Appeal vom Saddam-Regime finanziert wurde. Galloway selbst streitet alles ab: „Die Behauptung, dass die humanitären und politischen Aktivitäten des ‚Mariam Appeal’ unsachgemäß finanziert worden seien, ist offensichtlich falsch. Der Mann, der die Quelle ‚unsachgemäßer Spenden’ sein soll – Fawaz Zuriekat –, bestreitet jedes Fehlverhalten. Er wurde nie einer Rechtsverletzung angeklagt, reist als freier Mann in den USA herum und geht seinen Geschäften im Irak unter der Marionettenregierung und seinen angloamerikanischen Herren nach. Ich habe außerdem immer die Sichtweise der Charity Commission bestritten, dass eine Kampagne mit dem Ziel, Veränderungen in der nationalen und internationalen Politik herbeizuführen, etwas mit Wohlfahrt zu tun hat.“ Dass Zuriekats Gelder zu einem Großteil aus dem Verkauf irakischen Öls unter dem Saddam-Regime stammten, will Galloway nicht gewusst haben.
Die Rolle der verfolgten Unschuld spielt er nicht sehr überzeugend. Mit dem einmonatigen Ausschluss aus dem britischen Parlament ist George Galloway noch gut bedient – vor allem, wenn man bedenkt, dass er einer der prominentesten Unterstützer der Baathisten war. Längst ist ihm auch die Hizbollah ans Herz gewachsen. Mal sehen, welche Spendenkampagne ihm als nächste einfällt.
Übersetzungen: Lizas Welt – Hattip: barbarashm