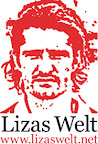Abseitsfalle für Mullahs!
 Vorab eine, nun ja, Binsenweisheit: Fußball ist fast überall – immer noch – eine Männerdomäne, sowohl was die Aktiven betrifft als auch in Bezug auf das Publikum. Eine der wenigen diesbezüglichen Ausnahmen bilden die USA: Dort ist Frauenfußball nicht nur deutlich populärer als sein männliches Pendant, sondern zudem professioneller, weiter verbreitet und selbstverständlicher als in jedem anderen Land. Zwar steigt allmählich nahezu überall sowohl seine gesellschaftliche Akzeptanz als auch die Zahl der Spielerinnen, aber der Stellenwert des Männerfußballs bleibt bislang größer, übrigens auch bei den zahlreicher gewordenen weiblichen Fans.
Vorab eine, nun ja, Binsenweisheit: Fußball ist fast überall – immer noch – eine Männerdomäne, sowohl was die Aktiven betrifft als auch in Bezug auf das Publikum. Eine der wenigen diesbezüglichen Ausnahmen bilden die USA: Dort ist Frauenfußball nicht nur deutlich populärer als sein männliches Pendant, sondern zudem professioneller, weiter verbreitet und selbstverständlicher als in jedem anderen Land. Zwar steigt allmählich nahezu überall sowohl seine gesellschaftliche Akzeptanz als auch die Zahl der Spielerinnen, aber der Stellenwert des Männerfußballs bleibt bislang größer, übrigens auch bei den zahlreicher gewordenen weiblichen Fans.Im Iran ist das durchaus nicht anders – und dennoch unterscheiden sich die Möglichkeiten für dort lebende Frauen, aktiv oder passiv an der auch in diesem Land führenden Sportart teilzuhaben, massiv von denen in anderen Teilen der Welt. Es gibt zwar ein iranisches Frauenfußball-Nationalteam, doch dem sind Spiele in der Öffentlichkeit nur jenseits der Landesgrenzen gestattet, und auch da haben die Kickerinnen alle Teile ihres Körpers außer dem Gesicht und den Händen zu verhüllen, also mit Kopftüchern und langen Hosen anzutreten. Im Iran selbst ist das Kicken nur hinter verschlossenen Türen möglich, das heißt zumeist in Turnhallen.
Gleichwohl möchten auch dort immer mehr Mädchen und Frauen gegen das Leder treten, und darüber hinaus steigt die Zahl derjenigen, die es nicht mehr hinnehmen wollen, vom Stadionbesuch ausgeschlossen zu sein. Nach dem Sturz des Schahs und dem schließlichen Sieg der so genannten islamischen Revolution 1979 hatte das neue Regime ein entsprechendes Verbot erlassen, das für dreißig Jahre Gültigkeit besitzen sollte. Nur in ganz seltenen Fällen machen die Mullahs eine generöse Ausnahme – wenn ihr Opportunismus es gebietet: Als etwa die deutsche Nationalmannschaft im Oktober 2004 zu einem Testspiel in Teheran antrat und im Vorfeld Kritik daran laut wurde, dass ausschließlich Männer Zutritt zu diesem Match erhalten sollten, gestattete das Regime sage und schreibe 200 Frauen den Einlass, die voll vermummt und in einem separaten, abgeschirmten Block die Begegnung gemeinsam mit den übrigen 99.800 – männlichen – Zuschauern ansehen durften. Gelegentlich versuchen Frauen jedoch auf eigene Faust, das Verbot zu umgehen und auf die Tribünen zu kommen – wie im Juni vergangenen Jahres, als 33 von ihnen während eines Spiels das Stadion in der iranischen Hauptstadt stürmten und daraufhin von der Polizei brutal zusammengeknüppelt wurden.
Am vergangenen Mittwoch nun trat die iranische Nationalmannschaft der Männer in Teheran zu einem WM-Vorbereitungsspiel gegen die Auswahl Costa Ricas an – die erste Partie seit langem, nachdem sich infolge der Wahl Ahmadinedjads zum Staatspräsidenten etliche Länder geweigert hatten, gegen die Eleven des Gottesstaates zu spielen. Zur Feier des Tages ließ sich der iranische Diktator vorher – propagandistisch wirksam im Nationaltrikot – beim Kicken mit den Auswahlspielern fotografieren. Im Rahmen des Spiels kam es jedoch auch zu einer Aktion, die – wie könnte es anders sein – in den hiesigen Medien vollständig übergangen wurde: Eine Gruppe junger iranischer Frauen hatte beschlossen, das Match live vor Ort zu verfolgen. Und da sie nicht damit rechnen konnten, dass ihr Anliegen die Zensur der heimischen Presse passieren würde, veröffentlichten sie es einige Tage vor dem Anstoß unter dem Titel We have decided to challenge the law in verschiedenen Blogs. Unter denen, die sich an der Werbung für dieses bewusste und offensive Einfordern selbstverständlicher Rechte beteiligten, waren auch einige iranische Nationalspielerinnen. In dem Aufruf hieß es:
„Es ist Ironie, dass Frauen – die eine anerkannt entscheidende Rolle beim Sieg der Revolution von 1979 gespielt haben, die die Monarchie stürzte und eine Republik erbrachte – zu den ersten Gruppen gehörten, die von der heftig diskriminierenden Politik unterdrückt wurden. Das Verbot für Frauen, an Sportereignissen der Männer teilzunehmen, war eines der ganz frühen. Frauen haben knapp zwei Jahrzehnte dafür benötigt, sich zu verbünden, zu organisieren und offen ihre Rechte einzufordern.“
 Dutzende Frauen kauften sich anschließend Eintrittskarten für das Match der iranischen Männer gegen Costa Rica und wollten ins Stadion. Doch die Polizei verweigerte ihnen den Einlass. Daraufhin organisierten sie eine Demonstration vor den Toren der Arena mit dem zynischen Namen Azadi (Freiheit) und präsentierten Spruchbänder, auf denen „Azadi-Stadion: 100.000-nur-für-Männer-Arena“ und „Wir wollen auch unser Nationalteam anfeuern“ stand. Wie Iran Focus berichtet, wurde den meist jugendlichen Demonstrantinnen sofort die Verhaftung angedroht. Kurz darauf griffen die Polizisten die Frauen und Mädchen an, zwangen sie in einen Bus und steckten sie ins Gefängnis.
Dutzende Frauen kauften sich anschließend Eintrittskarten für das Match der iranischen Männer gegen Costa Rica und wollten ins Stadion. Doch die Polizei verweigerte ihnen den Einlass. Daraufhin organisierten sie eine Demonstration vor den Toren der Arena mit dem zynischen Namen Azadi (Freiheit) und präsentierten Spruchbänder, auf denen „Azadi-Stadion: 100.000-nur-für-Männer-Arena“ und „Wir wollen auch unser Nationalteam anfeuern“ stand. Wie Iran Focus berichtet, wurde den meist jugendlichen Demonstrantinnen sofort die Verhaftung angedroht. Kurz darauf griffen die Polizisten die Frauen und Mädchen an, zwangen sie in einen Bus und steckten sie ins Gefängnis.Einige Tage zuvor war auf der Berlinale ein Film des iranischen Regisseurs Jafar Panahi vorgestellt worden, der zumindest thematisch zu dieser Problematik passt: Offside (Abseits) heißt der Streifen, der die Geschichte iranischer Fußballanhängerinnen erzählt, die vergeblich versuchen, mit allerlei Tricks in das Stadion zu gelangen, wo das iranische Team gerade sein entscheidendes WM-Qualifikationsspiel bestreitet. Offside ist, glaubt man Panahi, eine „patriotische Liebeserklärung“ an sein Land, und doch macht es stutzig, dass das Werk im Iran gedreht werden und die Zensur unbeschadet überstand. „Es gab einige Versuche, den Film zu verhindern, aber ich habe alle Schwierigkeiten überwunden“, beschied der Regisseur entsprechende Fragen knapp. Dass er die staatlichen Hürden genommen hat, könnte unter anderem daran liegen, dass Offside offenbar von einem den dortigen Behörden unbekannten Mitarbeiter Panahis bei der zuständigen Stelle eingereicht wurde, nachdem sein letzter Film im Iran nicht gezeigt werden durfte.
 Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Regimekritiker und Exil-Iraner Recht haben, die in dem Streifen weniger eine gelungene Komödie über Frauen sehen, die den Verboten der Mullahs trotzen, sondern vielmehr regimekonforme Propaganda. Der Berliner Filmemacher Kia Kiarostami etwa erklärte: „Im Iran lebende regimekritische Künstler werden politisch verfolgt, landen im Gefängnis oder werden ermordet. Unbehelligt können nur Künstler und Intellektuelle arbeiten, die sich in irgendeiner Weise mit dem Regime arrangieren.“ Arman Nadjm, ein in Deutschland lebender iranischer Regisseur und Dramaturg, stieß ins gleiche Horn: „Die genehmigten Kinoproduktionen werden allesamt mit staatlichen Fördermitteln unterstützt. Finanzielle Hilfe erhalten natürlich nur diejenigen, die den Vorgaben des iranischen Kulturministeriums entsprechen“. Dem Offside-Regisseur Jafar Panahi warfen sie und andere Exil-Iraner daher vor, „insgeheim hinter der Politik der iranischen Führung zu stehen“, und den Berlinale-Verantwortlichen, „unfreiwillig ein faschistisches Regime“ zu unterstützen, „das nach fast drei Jahrzehnten Terror und schweren Menschenrechtsverletzungen im Lande mit atomaren Drohungen und antisemitischer wie antiisraelischer Haltung die Welt zu bedrohen versucht“. Filme wie Offside würden von den Mullahs begrüßt, weil sie dabei hülfen, die politische Isolation des Iran zu durchbrechen: „Es ist eine Riesenwerbung. In der iranischen Presse lautet der Tenor: Zwar meckert der Westen über uns, aber seht her, auf der Berlinale werden unsere Filme gelobt und gefeiert. Wir haben eine große Kultur, die der Westen bewundert“, sagte Kiarostami.
Wahrscheinlicher ist jedoch, dass die Regimekritiker und Exil-Iraner Recht haben, die in dem Streifen weniger eine gelungene Komödie über Frauen sehen, die den Verboten der Mullahs trotzen, sondern vielmehr regimekonforme Propaganda. Der Berliner Filmemacher Kia Kiarostami etwa erklärte: „Im Iran lebende regimekritische Künstler werden politisch verfolgt, landen im Gefängnis oder werden ermordet. Unbehelligt können nur Künstler und Intellektuelle arbeiten, die sich in irgendeiner Weise mit dem Regime arrangieren.“ Arman Nadjm, ein in Deutschland lebender iranischer Regisseur und Dramaturg, stieß ins gleiche Horn: „Die genehmigten Kinoproduktionen werden allesamt mit staatlichen Fördermitteln unterstützt. Finanzielle Hilfe erhalten natürlich nur diejenigen, die den Vorgaben des iranischen Kulturministeriums entsprechen“. Dem Offside-Regisseur Jafar Panahi warfen sie und andere Exil-Iraner daher vor, „insgeheim hinter der Politik der iranischen Führung zu stehen“, und den Berlinale-Verantwortlichen, „unfreiwillig ein faschistisches Regime“ zu unterstützen, „das nach fast drei Jahrzehnten Terror und schweren Menschenrechtsverletzungen im Lande mit atomaren Drohungen und antisemitischer wie antiisraelischer Haltung die Welt zu bedrohen versucht“. Filme wie Offside würden von den Mullahs begrüßt, weil sie dabei hülfen, die politische Isolation des Iran zu durchbrechen: „Es ist eine Riesenwerbung. In der iranischen Presse lautet der Tenor: Zwar meckert der Westen über uns, aber seht her, auf der Berlinale werden unsere Filme gelobt und gefeiert. Wir haben eine große Kultur, die der Westen bewundert“, sagte Kiarostami.Noch einige Gründe mehr also, auch fürderhin – und verstärkt – den Ausschluss des Iran von der Fußball-Weltmeisterschaft zu fordern, wiewohl das Gelingen dieses Unterfangens zweifellos noch unrealistischer geworden ist als es ohnehin schon war. Der Präsident des Weltfußballverbands FIFA, Sepp Blatter, hat entsprechende Forderungen unlängst erneut kategorisch zurückgewiesen. Die Bilder vor dem Spiel der iranischen Mannschaft gegen Costa Rica kann er nicht gesehen haben.
Hattip: pre-emptive strike