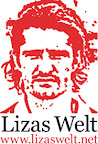Auschwitz spielen
 Manchmal wird man von der Gegenwart geradezu gezwungen, noch einmal alte Bücher aus dem Regal hervorzuholen. Ein „Biotop mit toten Juden“ nannte der viel zu früh verstorbene Eike Geisel* vor vierzehn Jahren die Kunstschau Jüdische Lebenswelten, die von den Berliner Festspielen seinerzeit mit allerlei Pomp ins Werk gesetzt worden war und deren Sinn und Zweck der Publizist so auf den Punkt brachte: „Die Ausstellung im Gropius-Bau ist eine mitunter wegen Überfüllung geschlossene Wallfahrtsstätte, an der sich die Besucher in einer Atmosphäre von Betroffenheit und Lust über die Toten hermachen, um deren imaginierte Eigenschaften zu verzehren. Im Unterschied zur selbstlosen Niedertracht der Nazis gehorcht diese frivole Kommunion dem ganz eigennützigen Zweck jener ‚erwachsenen Form nationaler Identitätssuche’, deren heimliche Devise lautet: am jüdischen Wesen soll Deutschland genesen.“ Geisel attackierte die Verlogenheit solcher Unternehmungen scharf und rückte ihren beabsichtigten moralischen Profit in den richtigen Kontext – „Ohne die Todeslager keine ‚Jüdischen Lebenswelten’“: „Alle beteuern angesichts der kulturellen Materialschlacht, wie groß der Verlust durch die Austreibung und Ermordung der Juden sei. Doch diesen Verlust hat in den letzten 50 Jahren nicht nur niemand verspürt; es ist gar keiner. [...] Die Klage über den Verlust ist nicht ernst gemeint. Es handelt sich dabei um eine weinerliche Selbstbezogenheit, nicht um Trauer über andere, sondern um Mitleid mit der eigenen Banalität, kurz: um die Behauptung, die Deutschen hätten sich mit ihren Verbrechen selbst etwas angetan.“
Manchmal wird man von der Gegenwart geradezu gezwungen, noch einmal alte Bücher aus dem Regal hervorzuholen. Ein „Biotop mit toten Juden“ nannte der viel zu früh verstorbene Eike Geisel* vor vierzehn Jahren die Kunstschau Jüdische Lebenswelten, die von den Berliner Festspielen seinerzeit mit allerlei Pomp ins Werk gesetzt worden war und deren Sinn und Zweck der Publizist so auf den Punkt brachte: „Die Ausstellung im Gropius-Bau ist eine mitunter wegen Überfüllung geschlossene Wallfahrtsstätte, an der sich die Besucher in einer Atmosphäre von Betroffenheit und Lust über die Toten hermachen, um deren imaginierte Eigenschaften zu verzehren. Im Unterschied zur selbstlosen Niedertracht der Nazis gehorcht diese frivole Kommunion dem ganz eigennützigen Zweck jener ‚erwachsenen Form nationaler Identitätssuche’, deren heimliche Devise lautet: am jüdischen Wesen soll Deutschland genesen.“ Geisel attackierte die Verlogenheit solcher Unternehmungen scharf und rückte ihren beabsichtigten moralischen Profit in den richtigen Kontext – „Ohne die Todeslager keine ‚Jüdischen Lebenswelten’“: „Alle beteuern angesichts der kulturellen Materialschlacht, wie groß der Verlust durch die Austreibung und Ermordung der Juden sei. Doch diesen Verlust hat in den letzten 50 Jahren nicht nur niemand verspürt; es ist gar keiner. [...] Die Klage über den Verlust ist nicht ernst gemeint. Es handelt sich dabei um eine weinerliche Selbstbezogenheit, nicht um Trauer über andere, sondern um Mitleid mit der eigenen Banalität, kurz: um die Behauptung, die Deutschen hätten sich mit ihren Verbrechen selbst etwas angetan.“Wie wahr und hellsichtig Geisels Analysen sind und wie ungebrochen ihr Gegenwartsbezug ist, ließe sich an ungezählten Beispielen demonstrieren, von denen hier nur das des Holocaust-Mahnmals in Berlin genannt sei: Es möge ein Monument errichtet werden, „zu dem man gerne geht“, hatte der seinerzeitige Bundeskanzler Gerhard Schröder gefordert – und das Stelenfeld exakt zu der gewünschten touristischen Attraktion gemacht, die zugleich Resultat der „erwachsenen Form nationaler Identitätssuche“ ist: Die Deutschen haben nicht nur den größten Völkermord der Geschichte verbuchen können, sondern dessen Opfern anschließend auch noch das größte Denkmal der Welt hingestellt. Hannes Stein hatte daher Recht, als er Anfang Mai letzten Jahres schrieb: „Nicht 2000 stilisierte Grabsteine hätten in Berlin zu stehen, sondern 2000 Galgen, wie sie nach den Nürnberger Prozessen Verwendung fanden, meinetwegen hübsch in Messing gegossen. Und unter jedem von ihnen müsste eine Plakette mit dem ausführlichen und exemplarischen Lebenslauf eines jener Massenmörder angebracht sein, wie sie nach dem Krieg zu Tausenden ungestraft herumliefen.“
Ein solches Kunstwerk hätte jedoch nicht zu den „einladenden Erlebnisräumen“ gehört, mit denen schon die Ausstellung Jüdische Lebenswelten warb und die seither nichts von ihrer Anziehungskraft auf die postnazistische deutsche Gesellschaft eingebüßt haben – ganz im Gegenteil: Unlängst baute etwa die Bundeszentrale für politische Bildung einen „Antifaschismus Vergnügungspark“ mit „Attraktionen wie Menschenschauen, Lachgaskammer, Galgenringelspiel, Dekonzentrationslager oder Aschenputteldusche“ auf und ließ dem Judenmörderfilm Paradise Now ein Begleitheft angedeihen, das Schülern den pädagogischen Wert dieses Streifens näher bringen sollte. Das Berliner Haus der Kulturen der Welt wiederum befasste sich mit dem „Gebilde, das wir Israel nennen“ – und verfehlte dabei den altantiimperialistischen Terminus zionistisch-faschistischer Siedlerstaat nur ganz knapp. Was fehlte noch? Das, was Anfang der 1990er Jahre schon einmal zur Diskussion stand und im Deutschen Historischen Museum errichtet werden sollte, bevor der Vorschlag doch noch kassiert wurde: der Nachbau einer Vergasungsanlage mit echtem Zyklon B-Geruch. Aber jetzt hat sich endlich einer getraut:
„Eine Synagoge bei Köln ist am Sonntag im Rahmen einer Kunstaktion zur ‚Gaskammer’ geworden. Der international bekannte Künstler Santiago Sierra leitet aus den Auspuffrohren von sechs Autos die hochgiftigen Abgase in das frühere jüdische Bethaus von Pulheim-Stommeln. Mit seiner Arbeit wolle er ‚gegen die Banalisierung der Erinnerung an den Holocaust’ angehen, erklärte der 39-jährige Sierra am Sonntag in einer schriftlichen Stellungnahme zu Beginn seines Projektes ‚245 Kubikmeter’.“Sie haben ganz richtig gelesen; die Meldung ist kein makabrer Witz. Welcher Teufel den Mann auch immer geritten haben mag: Er hat einen veritablen Volltreffer gelandet. Ein paar Auszüge aus der Berichterstattung mögen als Beleg genügen: „Schon unmittelbar nach Beginn der Aktion bildete sich eine Warteschlange vor der ehemaligen Synagoge. Viele Besucher wollten mit Atemschutzmaske und in Begleitung eines Feuerwehrmannes einzeln für wenige Minuten den Raum mit seiner lebensgefährlichen Konzentration an Kohlenmonoxid betreten“, fasste die Kölnische Rundschau zusammen und kündete von großer Euphorie: „‚Warst Du schon drin?’, lautete die oft gehörte banale (!) Frage unter den Wartenden. Die Anmeldeliste für die ‚Gaskammer’ an diesem Sonntag war rasch ‚ausgebucht’.“ Auch die Netzeitung weiß, dass die Mehrheit gar nicht irren kann, schon gar nicht in Deutschland: „Der Zentralrat der Juden in Deutschland spricht von einer ‚Beleidigung der Opfer’, doch (!) die Warteschlange vor der Synagoge in Pulheim ist lang: Jeder will mal mit Schutzmaske in das mit Kohlenmonoxid gefüllte Gebäude.“ Als „provokative Kunstaktion“ ging diese ungeheuerliche Obszönität bei so ziemlich allen Blättern durch.
Einsam blieb dagegen Stephan J. Kramer, Generalsekretär des Zentralrats der Juden in Deutschland, mit seiner Kritik: „Das Werk Sierras degradiert Geschichte zu einem fiktiven Spektakel und ist dabei nur schädlich. Ich frage mich, warum die Ermordeten des Holocaust und nicht die Täter derart provoziert werden.“ Der Initiator dieser besonders widerlichen Banalisierung der Erinnerung an die Shoa blieb ihm die Antwort schuldig – er war gar nicht erst erschienen. Und verpasste so den Ansturm auf die Synagoge, in der sich postnazistische Deutsche den Kick des wohligen Gruselns holen, den ihnen der Judenmord verschafft – weit mehr als ein Besuch des Holocaust-Mahnmals oder das Betrachten von Fotos mit Leichenbergen. „Warst du schon drin?“, fragen sie sich ganz unbeschwert und unternehmungslustig, als ob es um einen neuen Kinofilm ginge.
Und buchen einen Trip in die Gaskammersynagoge. Mal Auschwitz spielen. Besten Gewissens. Ist doch schließlich Kunst – und zwar in einer „mitunter wegen Überfüllung geschlossenen Wallfahrtsstätte, an der sich die Besucher in einer Atmosphäre von Betroffenheit und Lust über die Toten hermachen.“ Lebte Eike Geisel noch, er hätte sich bloß selbst zu zitieren brauchen. Vielleicht besser so, dass er nicht mehr mitbekommen musste, wie Recht er hatte.
* Eike Geisel: Die Banalität der Guten. Deutsche Seelenwanderungen, Berlin 1992 (Edition Tiamat)