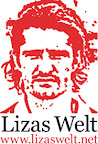Symbole einer Revolte?
 Nicht wenige Iranerinnen und Iraner haben das Mullah-Regime gründlich satt; insbesondere den Jüngeren reicht es zunehmend. Doch was tun gegen die Omnipräsenz der islamischen Tugendterroristen? Es gibt verschiedene Ausdrucksformen des Protests; demonstrative Partys, das Tragen westlicher Kleidung und andere unislamische Verhaltensweisen sind den Sittenwächtern gewiss ein Dorn im Auge. Doch längst nicht alle haben die Möglichkeit dazu, und ein Widerstand gegen das Regime sollte sich auch nicht darin erschöpfen, meint Tabandeh M. in ihrem Gastbeitrag.
Nicht wenige Iranerinnen und Iraner haben das Mullah-Regime gründlich satt; insbesondere den Jüngeren reicht es zunehmend. Doch was tun gegen die Omnipräsenz der islamischen Tugendterroristen? Es gibt verschiedene Ausdrucksformen des Protests; demonstrative Partys, das Tragen westlicher Kleidung und andere unislamische Verhaltensweisen sind den Sittenwächtern gewiss ein Dorn im Auge. Doch längst nicht alle haben die Möglichkeit dazu, und ein Widerstand gegen das Regime sollte sich auch nicht darin erschöpfen, meint Tabandeh M. in ihrem Gastbeitrag.„Die iranische Jugend hat einen großen Drang, Rock-Konzerte zu veranstalten und Ecstasy zu nehmen.“ – „Das Skilaufen wird zur beliebtesten größten Freizeitaktivität der Jugendlichen.“ – „Mutige junge Frauen legen auf den Bergen ihre Kopftücher ab und heben die sonst übliche Geschlechtertrennung auf.“Das war der Tenor eines kürzlich gesendeten Beitrags des TV-Magazins Weltspiegel mit dem Titel „Iran: Allahs ungehorsame Kinder“. Diese Präsentationsart iranischer Jugendlicher und Frauen ist keine Seltenheit. Häufig fokussieren die Berichte westlicher Medien auf einen kleinen Teil der jungen Generation und stellen ihn als repräsentativ für die gesamte Gesellschaft des Iran dar. Als „iranische Jugend“ oder „Allahs Kinder“ wird in diesem Zusammenhang zumeist eine Bevölkerungsgruppe im Alter von Anfang zwanzig bis Mitte dreißig aus der städtischen Ober- und Mittelschicht bezeichnet.
Der Weltspiegel-Bericht etwa zeigt eine 21-jährige Teheranerin namens „Bita“, die im Winter jedes Wochenende auf der Skipiste verbringe und den für Frauen vorgeschriebenen knielangen Mantel auf den Bergen nicht trage. Das gesamte Outfit von „Bita“ ist über eine Million Tuman (ca. 1.000 Euro) wert – das entspricht dem Jahresgehalt eines einfachen Angestellten –, und die Kosten für ein solches Wochenende in den Bergen belaufen sich auf geschätzte 50.000 Tuman (ca. 50 Euro); das ist ein halbes Monatsgehalts eines einfachen Arbeiters. Offenbar sind „Bita“ und ihre Leidensgenossen finanziell also in der Lage, im Winter ihre Wochenenden im Schnee und ihre sonstige Freizeit möglicherweise mit anderen nicht ganz billigen Freizeitaktivitäten wie Rock-Konzerten zu verbringen. Charakteristisch für junge Iranerinnen und Iraner ist das allerdings nicht.
Eine weitere Sequenz in der Sendung zeigt „Sannaz“:
„Sannaz und ihre Freunde haben das Kopftuch abgelegt. Eigentlich steht darauf die Peitsche. Jedes Wochenende feiern sie eine stille Revolte gegen die Islamische Republik. Und die ist ihnen wichtiger als das Tauziehen ums Atomprogramm“.Es ist zweifellos begrüßenswert, wenn ein paar junge Frauen wenigstens auf den Bergen ihre Kopftücher ablegen können. Dennoch sei darauf hingewiesen, dass sie offenbar das entsprechende Bußgeld auch zahlen können. Denn bekanntlich gibt es in dem korrupten Iran die Möglichkeit, sich in solchen Fällen von den obligatorischen Peitschenhieben frei zu kaufen.
Durch das Hervorheben einer kleinen, vergleichsweise verwöhnten Bevölkerungsgruppe – deren Hauptsorge offensichtlich entweder ihre Freizeitgestaltung ist oder die es sich leisten kann, ihre Sorgen auf diese Weise zu verdrängen – rückt die Lebenssituation größerer Bevölkerungsgruppen in den Hintergrund. Beiträge wie der des Weltspiegel unterstellen zum einen, dieser Teil der Jugendlichen, dem Atompolitik und Karikaturenstreit angeblich egal sind, stehe sinnbildlich für die gesamte iranische Bevölkerung; zum anderen reduzieren sie mehr oder weniger subtil Subversion und den Kampf um die Frauen- und Menschenrechte auf Freizeitaktivitäten, die den Protest gegen das Mullah-Regime kennzeichnen sollen.
 Seit 27 Jahren wird es in diesen Breitengraden bedauert, dass iranische Mädchen und Jungen in der Öffentlichkeit nicht Händchen halten dürfen und Mädchen und Frauen obligatorisch ein Kopftuch tragen müssen. In den 1980er und 1990er Jahren wurden bereits ein paar aus dem nach hinten gerutschten Kopftuch heraus schauende, oft blondierte Haarsträhnen als Ausdruck von Widerstand idealisiert. Einige Jahre danach waren es die bunten Kopftücher und noch später die hautengen Uniformen und Hosen, die als Inbegriff zivilen Ungehorsams galten. Dabei wurde und wird verkannt, dass all dies zwar punktuell einen Protest gegen Reglementierungen des Regimes darstellt, aber keineswegs bereits eine angemessene und ausreichende Antwort auf die Entwürdigungen und Angriffe auf die Menschenrechte im Allgemeinen und auf die Recht der Frauen im Besonderen ist. Viele Beobachter interpretierten stets mehr in diese Verweigerungen hinein, als es angemessen war; damit überschätzten sie die tatsächliche – beschränkte – Tragweite eines solchen „Widerstands“. Bitter hierbei ist, dass dieser Ungehorsam sich im Kreis dreht und zum Selbstzweck geworden ist. Mit unverhohlenem Hochmut berichten die westlichen Medien noch immer darüber, dass die „iranische Jugend“ sich entgegen sämtlicher Verbote alle denkbaren Rauschmittel besorge und der Drogenkonsum die denkbar höchste Rate im Iran erreicht habe.
Seit 27 Jahren wird es in diesen Breitengraden bedauert, dass iranische Mädchen und Jungen in der Öffentlichkeit nicht Händchen halten dürfen und Mädchen und Frauen obligatorisch ein Kopftuch tragen müssen. In den 1980er und 1990er Jahren wurden bereits ein paar aus dem nach hinten gerutschten Kopftuch heraus schauende, oft blondierte Haarsträhnen als Ausdruck von Widerstand idealisiert. Einige Jahre danach waren es die bunten Kopftücher und noch später die hautengen Uniformen und Hosen, die als Inbegriff zivilen Ungehorsams galten. Dabei wurde und wird verkannt, dass all dies zwar punktuell einen Protest gegen Reglementierungen des Regimes darstellt, aber keineswegs bereits eine angemessene und ausreichende Antwort auf die Entwürdigungen und Angriffe auf die Menschenrechte im Allgemeinen und auf die Recht der Frauen im Besonderen ist. Viele Beobachter interpretierten stets mehr in diese Verweigerungen hinein, als es angemessen war; damit überschätzten sie die tatsächliche – beschränkte – Tragweite eines solchen „Widerstands“. Bitter hierbei ist, dass dieser Ungehorsam sich im Kreis dreht und zum Selbstzweck geworden ist. Mit unverhohlenem Hochmut berichten die westlichen Medien noch immer darüber, dass die „iranische Jugend“ sich entgegen sämtlicher Verbote alle denkbaren Rauschmittel besorge und der Drogenkonsum die denkbar höchste Rate im Iran erreicht habe.Die Fehleinschätzung, Konsum und westlicher Lebensstil seien bereits ultimative Formen und Symbole einer Revolte gegen das islamistische Regime und darüber hinaus Inbegriffe von Freiheit, rückt erstens das eigentlich Relevante – nämlich die Frage des Rechts auf ein Leben ohne die Zumutungen der Mullahs – in den Hintergrund, und zweitens evoziert sie die falsche Vorstellung, dass die tagtäglichen Menschenrechtsverletzungen und die Missachtung der Würde des Menschen mit der Farbe und dem Design der Kleidung sowie dem Besteigen der Berge aus der Welt zu schaffen seien. Die anfänglich als „Widerstand“ apostrophierten Bedürfnisse entwickelten sich im Laufe der Jahre zu einem großen Drang nach westlichem Lebensstil und Konsum, doch die ihm unterstellte Zielvorstellung blieb auf der Strecke.
Wenn die Medien, anstatt ihre Aufmerksamkeit auf derlei Äußerlichkeiten zu richten, mehr Interesse an weiteren Stimmen und Strömungen in der iranischen Gesellschaft zeigten, könnte ein realitätsnäheres Bild zustande kommen. Wären in der Weltspiegel-Sendung neben „Bita“ und „Sannaz“ beispielsweise auch einige tausend Frauen gezeigt worden, die gemeinsam mit der Schriftstellerin Simin Behbahani anlässlich des internationalen Frauentages am 8. März dieses Jahres an einer Kundgebung für die Freiheit und gegen die Geschlechtertrennung teilnahmen und brutal niedergeschlagen wurden, würden die Menschen in den westlichen Gesellschaften darüber informiert, dass es noch weitergehende Lösungen für iranische Jugendliche gibt, als auf die Berge gehen zu müssen, um ihre Frustrationen abzuladen.
Es ist wichtig, dass die westlichen Medien ein realistisches Gesamtbild der Situation iranischer Jugendlicher zeigen. Denn erstens würde dieses Bild zurück in den Iran wirken und könnte einen Beitrag dazu leisten, dass Menschen dort erfahren, was wirklich in ihrem Land geschieht. Und zweitens könnte die Weltöffentlichkeit besser für das tatsächliche Geschehen im Iran sensibilisiert werden. Wenn sich die westlichen Medien jedoch auf eine Scheinrealität und auf die Oberfläche des Lebens der Jugendlichen und der Frauen konzentrieren, bleibt das tatsächliche Leben vieler Menschen im Dunkeln. Verzerrte Bilder wecken keine Hoffnung und Motivation im Iran – sie bestärken nur die Frustration und das Bedürfnis nach Vergessen und Verdrängen.