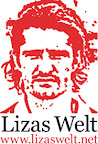Mehr als nur ein Flirt
 In Havanna treffen sich auf einer blockfreien Konferenz höchstrangige Repräsentanten Venezuelas, Kubas, Nordkoreas sowie der palästinensischen Autonomiebehörde und des Iran, um Terrorismus zu einer legitimen Form des „Widerstands gegen Besatzung“ zu verniedlichen und das iranische Atomprogramm zu feiern. Kurz darauf reist der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedjad nach Caracas, unterzeichnet dort mit seinem venezolanischen Pendant Hugo Chávez ein weitreichendes Abkommen und betont die Verbundenheit beider Staaten im Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Chávez nennt auf der UNO-Vollversammlung den amerikanischen Präsidenten „den Teufel“, während auch sein iranischer Amtskollege dort über die Vereinigten Staaten und Israel herzieht. Beide hatten bereits im August Bruderschaft gefeiert und waren sich darin einig, dass Israel mindestens so schlimm ist wie Nazideutschland. In Europa demonstrieren Friedensbewegte Seit’ an Seit’ mit Islamisten gegen Israel und die USA – in London (untere Fotos) unlängst beispielsweise unter dem Motto „Wir sind alle Hizbollah“ –, halten 9/11 nicht selten für das Werk der CIA und des Mossad und schwärmen für die Hamas.
In Havanna treffen sich auf einer blockfreien Konferenz höchstrangige Repräsentanten Venezuelas, Kubas, Nordkoreas sowie der palästinensischen Autonomiebehörde und des Iran, um Terrorismus zu einer legitimen Form des „Widerstands gegen Besatzung“ zu verniedlichen und das iranische Atomprogramm zu feiern. Kurz darauf reist der iranische Präsident Mahmud Ahmadinedjad nach Caracas, unterzeichnet dort mit seinem venezolanischen Pendant Hugo Chávez ein weitreichendes Abkommen und betont die Verbundenheit beider Staaten im Kampf gegen den gemeinsamen Feind. Chávez nennt auf der UNO-Vollversammlung den amerikanischen Präsidenten „den Teufel“, während auch sein iranischer Amtskollege dort über die Vereinigten Staaten und Israel herzieht. Beide hatten bereits im August Bruderschaft gefeiert und waren sich darin einig, dass Israel mindestens so schlimm ist wie Nazideutschland. In Europa demonstrieren Friedensbewegte Seit’ an Seit’ mit Islamisten gegen Israel und die USA – in London (untere Fotos) unlängst beispielsweise unter dem Motto „Wir sind alle Hizbollah“ –, halten 9/11 nicht selten für das Werk der CIA und des Mossad und schwärmen für die Hamas.Woher kommt diese Allianz zwischen Linken und Djihadisten, die in den letzten Jahren stetig enger geworden ist? Welche Grundlagen hat dieses Bündnis zwischen sich progressiv wähnenden Gruppen und Parteien, die sich sozialistisch oder kommunistisch nennen und normalerweise eher säkular sind, auf der einen Seite und den Gotteskriegern respektive deren Anhängerschar auf der anderen Seite? Wie kann es sein, dass Organisationen, die sich das Ende von Ungleichheit, Unfreiheit und Unterdrückung auf die zumeist roten Fahnen geschrieben haben, ihre Gemeinsamkeiten mit Rackets entdecken, deren Programm und Praxis aus extremem Autoritarismus, einem bizarren Todeskult, völliger Rechtlosigkeit und der Pflicht zum heiligen Krieg besteht?
Derlei Fragen sind nicht umfassend mit dem Verweis darauf beantwortet, beide Bewegungen seien antiwestlich. Denn so freundlich gesonnen wie im Moment waren sich islamistische und linke Strömungen und Organisationen nicht immer. „Lange bevor die Muslimbruderschaft, die Djihadisten und andere islamische Militante den ‚Imperialismus’ angriffen, attackierten und töteten sie die Linken“, schrieb Fred Halliday in einem informativen Beitrag für openDemocracy.* Dabei gestalteten sich die Beziehungen zwischen beiden anfänglich durchaus zuvorkommend; sie begannen unmittelbar nach der Oktoberrevolution in Russland 1917, als die noch junge Sowjetunion „antiimperialistische“ Bewegungen in Asien gegen die Kolonialmächte Großbritannien, Frankreich und Niederlande unterstützte und in den militanten Muslimen dabei zumindest taktische Verbündete sah. Denn die Sowjets entdeckten im Islam sozialistische Elemente, wie Halliday ausführt: „Ein Koranvers, in dem es heißt, dass ‚Wasser, Erde und Feuer den Völkern gemeinsam gehören’, wurde als frühe, nomadische Form kollektiver Produktionsmittel interpretiert; die muslimischen Konzepte von ‚ ijma’’ (Konsensus), ‚ zakat’ (wohltätige Spenden) und ‚‘adala’ (Gerechtigkeit) wurden in einer Linie mit den Bestimmungen des ‚nicht-kapitalistischen’ Weges gesehen. Der Djihad war offensichtlich eine Form des antiimperialistischen Kampfes. Einen ähnlichen Abgleich von islamischer Tradition und modernem Staatssozialismus gab es in den sechs muslimischen Republiken der Sowjetunion.“
Die Begeisterung islamischer Gruppen für die kommunistische Idee hielt sich umgekehrt, vorsichtig formuliert, jedoch in ausgesprochen engen Grenzen; sie sahen weniger die Affinitäten, sondern positionierten sich mit der Zeit immer strikter gegen Kommunismus, Sozialismus, Liberalismus und Frauenrechte. Vor allem der organisierte Islamismus, der sich an den Grundsätzen der 1928 in Ägypten gegründeten Muslimbruderschaft orientierte, hielt den Sozialismus in all seinen Formen für eine westliche Erfindung, die scharf bekämpft werden müsse, zumal sie in der arabischen Welt an Einfluss gewann. Gleichzeitig lernten die Islamisten von ihren Rivalen: Die antiimperialistische Rhetorik, ein System sozialer Reformen und zentralistische Parteien beispielsweise ähnelten dem sozialistischen Pendant stark und finden heute ihre Fortsetzung in Attacken gegen die Globalisierung und den „Kulturimperialismus“. Ayatollah Khomeinis Denunziationen des „Liberalismus“ wirkten wie aus einem Handbuch des Stalinismus abgeschrieben, und auch Osama bin Ladens Botschaften kennzeichnet eine linke Phraseologie: Unsere Länder sind vom Imperialismus besetzt, unsere Herrscher verraten unsere Interessen, der Westen raubt unsere Ressourcen, wir sind Opfer doppelter Standards. Der dessen ungeachtet stattfindende Kampf des Islamismus gegen linke Bewegungen und sozialistische Staaten kam dem Westen dabei lange Zeit gelegen; vor allem im Kalten Krieg wurden islamische Organisationen und Länder häufig als Bündnispartner betrachtet und unterstützt. Halliday nennt in diesem Zusammenhang unter anderem Ägypten, Saudi Arabien, Indonesien, Marokko, die Türkei, Afghanistan, Jemen und Algerien als Beispiele.
Doch der Flirt der Linken mit dem Islam hörte trotz aller Katastrophen, die sie im Laufe der Jahre immer wieder erleben mussten, nicht auf; zu stark war und ist offenkundig das Bedürfnis, nach Gemeinsamkeiten im Kampf gegen „den Imperialismus“ zu fahnden, vor allem dann, wenn es gegen Israel und die USA geht. Warum das so ist und welche ideologischen Kongruenzen es zwischen zwei Lagern gibt, die Antipoden sein müssten und es doch nicht sind, wusste Clemens Nachtmann in seinem Beitrag Anti-Imperialismus – höchstes Stadium des falschen Anti-Kapitalismus bereits 1996. Der Text hat auch zehn Jahre später nichts an Aktualität eingebüßt – im Gegenteil – und soll daher in Auszügen dokumentiert werden.
 Clemens Nachtmann
Clemens NachtmannAnti-Imperialismus – höchstes Stadium des falschen Anti-Kapitalismus
[...] Auffällig ist zunächst, dass im Anti-Imperialismus davon ausgegangen wird, alles Elend in der sogenannten „Dritten Welt“ sei zurückzuführen auf einen Verursacher, welcher es bewusst und mit böser Absicht produziert und aufrecht erhält. Dieses finstere Subjekt soll nun der „Imperialismus“ sein. Wenn Linke also vom „Imperialismus“ reden, dann ist mit diesem Begriff weder, wie bei Lenin, ein bestimmtes „Stadium“ in der Entwicklung des Kapitalismus noch, wie eine lexikalische Definition uns lehrt, Expansions- und Machtstreben, also eine Eigenschaft von Staaten gemeint. Vielmehr ist „Imperialismus“ der Name für ein weltweit handelndes Subjekt, das zwar als bewusst und selbstbewusst handelndes auf der Weltbühne auftritt, als solches aber merkwürdig blass und unbestimmt bleibt und somit greifbar nur an seinen Erscheinungsformen ist: skrupellosen Multis, fiesen Bankern, finsteren Counterinsurgency-Strategen, stiernackigen Militärs, gegen welche [..] dann auch anti-imperialistischerseits mit großer moralischer Verve zu Felde gezogen wird und [die], zusammenaddiert, das Subjekt „Imperialismus“ ergeben.
Konstitutiv für den gemeinplätzlichen linken Imperialismus-Begriff ist also die Annahme, die unmittelbaren Nutznießer und Profiteure der bürgerlichen Gesellschaft seien deren bewusste und selbstbewusste Subjekte. Diese Annahme gründet wiederum in einem auf die sozialdemokratische und parteikommunistische Bewegung zurückgehenden, personalisierenden Missverständnis des Kapitalverhältnisses und der bürgerlichen Gesellschaft. Danach soll das ausschlaggebende Merkmal der bürgerlichen Gesellschaft darin bestehen, dass in ihr sich verschiedene Kollektiv-Subjekte gegenübertreten, die an und für sich nichts miteinander zu tun haben und sich nur äußerlich, durch ihre jeweiligen kollektiven Interessens- und Willenshandlungen aufeinander beziehen. Innergesellschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesen Kollektiv-Subjekten um die altbekannten Klassen: die Kapitalisten, die aus bösem Willen, d.h. subjektiver „Profitgier“ die Proleten ausbeuten und mit Hilfe ihres „Erfüllungsgehilfen“, des Staates, unterdrücken; und die Arbeiter, die als wesenhaft unversöhnliche Antagonisten des Kapitals „objektiv“ beständig Klassenkampf führen. [...]
 Das Kapital, das sich anfangs noch der Person des freien Unternehmer-Subjekts als seiner Krücke bediente, hat längst die ihm adäquate, anonyme Form der Aktiengesellschaften angenommen. Als Gesellschaftskapital hat es [...] die Arbeit restlos sich subsumiert. Das Kapital ist empirisch zu dem geworden, was es seinem materialistischen Begriff nach immer schon war: Herrschaft versachlichter Verhältnisse über die Individuen. Das personalistische Gesellschaftsverständnis samt der in ihm implizierten moralischen Kapitalismuskritik und der kernigen Klassenkampfrhetorik ist damit an sich unwiderruflich vernichtet, mit der Konsequenz, dass den diesen Denkfiguren nachhängenden Linken außer immer wahnhafteren und hilfloseren Subjekt-Beschwörungsformeln meist nichts mehr einfällt. Dafür darf sich die moralisierende Kritik umso mehr am Thema Imperialismus schadlos halten. Hier kann die moralisierende Kritik wieder ganz mit sich im reinen sein, scheint man es doch beim Verhältnis Imperialismus/Dritte Welt nicht nur mit einem unmittelbaren Gewaltverhältnis zu tun zu haben, sondern einem Gewaltverhältnis, das zudem den unschätzbaren Vorteil bietet, dass es in seiner ganzen Nacktheit bloßzuliegen scheint, bei dem also keine diffizile theoretische Tüftelarbeit vonnöten, sondern der bloße Augenschein zu genügen scheint, um es als solches zu erkennen. [Weshalb] jede Befreiung davon keinerlei Begründung mehr bedarf, sonder sich bereits durch die Tat rechtfertigt, was umgekehrt auch heißt, dass sich eine Kritik an den Zielen der Befreiung geradezu blasphemisch ausnimmt und sofort in den Verdacht gerät, in objektiver Komplizenschaft zum „Imperialismus“ zu stehen.
Das Kapital, das sich anfangs noch der Person des freien Unternehmer-Subjekts als seiner Krücke bediente, hat längst die ihm adäquate, anonyme Form der Aktiengesellschaften angenommen. Als Gesellschaftskapital hat es [...] die Arbeit restlos sich subsumiert. Das Kapital ist empirisch zu dem geworden, was es seinem materialistischen Begriff nach immer schon war: Herrschaft versachlichter Verhältnisse über die Individuen. Das personalistische Gesellschaftsverständnis samt der in ihm implizierten moralischen Kapitalismuskritik und der kernigen Klassenkampfrhetorik ist damit an sich unwiderruflich vernichtet, mit der Konsequenz, dass den diesen Denkfiguren nachhängenden Linken außer immer wahnhafteren und hilfloseren Subjekt-Beschwörungsformeln meist nichts mehr einfällt. Dafür darf sich die moralisierende Kritik umso mehr am Thema Imperialismus schadlos halten. Hier kann die moralisierende Kritik wieder ganz mit sich im reinen sein, scheint man es doch beim Verhältnis Imperialismus/Dritte Welt nicht nur mit einem unmittelbaren Gewaltverhältnis zu tun zu haben, sondern einem Gewaltverhältnis, das zudem den unschätzbaren Vorteil bietet, dass es in seiner ganzen Nacktheit bloßzuliegen scheint, bei dem also keine diffizile theoretische Tüftelarbeit vonnöten, sondern der bloße Augenschein zu genügen scheint, um es als solches zu erkennen. [Weshalb] jede Befreiung davon keinerlei Begründung mehr bedarf, sonder sich bereits durch die Tat rechtfertigt, was umgekehrt auch heißt, dass sich eine Kritik an den Zielen der Befreiung geradezu blasphemisch ausnimmt und sofort in den Verdacht gerät, in objektiver Komplizenschaft zum „Imperialismus“ zu stehen.Obwohl das personalisierende Gesellschaftsverständnis mit all seinen Implikationen in der linken Imperialismus-Vorstellung nicht nur beibehalten, sondern auf die Spitze getrieben ist, vor allem, was den moralischen Impetus anbetrifft, so besteht doch dessen spezifische Differenz darin, dass der „Grundwiderspruch“, der aufgemacht wird, keiner mehr zwischen „Klassen“ ist, sondern der zwischen dem Moloch „Imperialismus“, der in Form von Konzernen, Banken, Politikern, aber auch als mehrere „imperialistische Nationen“ auftreten kann, und den Völkern der „Dritten Welt“, deren Elend wesentlich darauf beruhen soll, dass sie vom „Imperialismus“ fremdbestimmt werden.
Bereits, wenn man ihn nur sprachkritisch unter die Lupe nimmt, transportiert der Begriff der „Fremdbestimmung“ die miefende Gemütlichkeit des Bei-sich-selberbleiben-Wollens, die Parteinahme fürs Bewährte, Angestammte und Identische, in welcher unmittelbar das rohe und barbarische Ressentiment gegen das Fremde, Unvertraute und Vermittelte impliziert ist. Den Begriff der „Fremdbestimmung“ zeichnet ferner aus, dass er an sich selbst völlig unbestimmt ist und sich deshalb allen nur denkbaren Phänomenen überstülpen lässt. Das wird von Anti-Imperialisten denn auch weidlich ausgenützt, wenn dem „Imperialismus“ nicht nur vorgeworfen wird, dass er die Völker der „Dritten Welt“ ausbeute, sondern ihnen vor allem verwehre, ihr Dasein ihren eigenen Sitten, Gebräuchen und „gewachsenen“ Kulturen gemäß zu fristen. In der Agitation gegen den „Imperialismus“ als „Fremdbestimmung“ der Völker erscheint zudem in Reinkultur jenes kulturkritische Gewäsch, in welchem über die „Kälte“ und „Entfremdung“ im Kapitalismus, die auf Rationalität und Abstraktion zurückzuführen sei, lamentiert wird. Die Figur des „edlen Wilden“, der gerade kraft unverbildet-ursprünglichen Lebenswandels fähig sei, die Verderbtheit der „westlichen Zivilisation“ schonungslos anzuprangern, zählt zum Standardrepertoire der Freunde kämpfender Völker. Kein Wunder, dass unzählige anti-imperialistische Pamphlete in harmloseren Fällen sich ausnehmen wie Reprints des „Papalagi“, in schlimmeren Fällen wie Remakes nationalsozialistischer oder neurechter Pamphlete. [...]
 Als falsche Analyse ist das Gefasel von der „Fremdbestimmung“ unmittelbar zugleich die adäquate Ideologie der „wahren“ nationalen Selbstbestimmung. In dem Maße, worin die Nation – Vermittlungsinstanz des Weltmarkts – als Bastion gegen den Weltmarkt und damit als rein auf sich gegründete Einheit des schaffenden Volkes gesetzt werden soll, muss der Befreiungsnationalismus seine stets vorhandenen substantialistischen – kulturalistischen oder völkischen – Züge offen hervorkehren. Nationale Unabhängigkeit wird dann als Wiederaneignung einer vom „Imperialismus“ bzw. seinen durch „westliche Werte“ verdorbenen Statthaltern unterdrückten und verschütteten „nationalen Würde“ ausgegeben. In praxi bedeutet das die bedingungslose Unterwerfung der Einzelnen unters Diktat der Staatsräson und die Todesdrohung gegen jeden, der dagegen aufbegehrt. „Patria libre o morir!“ – in dieser unüberbietbar mörderischen Formel ist griffig zusammengefasst, wofür nationale Befreiung steht. [...]
Als falsche Analyse ist das Gefasel von der „Fremdbestimmung“ unmittelbar zugleich die adäquate Ideologie der „wahren“ nationalen Selbstbestimmung. In dem Maße, worin die Nation – Vermittlungsinstanz des Weltmarkts – als Bastion gegen den Weltmarkt und damit als rein auf sich gegründete Einheit des schaffenden Volkes gesetzt werden soll, muss der Befreiungsnationalismus seine stets vorhandenen substantialistischen – kulturalistischen oder völkischen – Züge offen hervorkehren. Nationale Unabhängigkeit wird dann als Wiederaneignung einer vom „Imperialismus“ bzw. seinen durch „westliche Werte“ verdorbenen Statthaltern unterdrückten und verschütteten „nationalen Würde“ ausgegeben. In praxi bedeutet das die bedingungslose Unterwerfung der Einzelnen unters Diktat der Staatsräson und die Todesdrohung gegen jeden, der dagegen aufbegehrt. „Patria libre o morir!“ – in dieser unüberbietbar mörderischen Formel ist griffig zusammengefasst, wofür nationale Befreiung steht. [...]Die Konsequenzen der linken Parteinahme für „nationale Befreiungsbewegungen“ liegen heute klar auf der Hand. Im Kampf der von den Linken mitgeprägten „neuen sozialen Bewegungen’ gegen das „Sterben“ des deutschen Waldes und die Raketen der amerikanischen „Besatzer“, der mit der Wiederentdeckung von Brauchtum, Mundart und dem angeblich vierschrötig-eigensinnigen Widerständlertum der „ganz normalen Leute“ einherging, wurden die im Anti-Imperialismus erprobten völkischen Denkformen nun auch im Kampf an der Heimatfront hoffähig gemacht. [...]
* Übersetzung der Auszüge: Lizas Welt