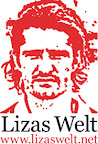Intifada, bühnenreif
 Niemand, wirklich niemand würde sich nachsagen lassen wollen, nicht genug für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, zu unternehmen. Am allerwenigsten natürlich staatliche Institutionen und Einrichtungen, denen es bekanntlich ohn’ Unterlass darum zu tun ist, ein friedliches Miteinander zwischen autochthonen Deutschen und den zu ausländischen Mitbürgern objektivierten Einwanderern zu gewährleisten. Kultur gilt in diesem Zusammenhang als ganz besonders geeignet, um Vorurteile abzubauen und für Verständnis zu werben. Also förderte der Berliner Senat von Herzen gerne das Stück „Intifada im Klassenzimmer“ des „Jugendtheaters für Frieden und Gerechtigkeit – gegen Antisemitismus und Islamophobie“ und wies hernach die Kritik, die Darbietung sei selbst antisemitisch, als unbegründet zurück. Dabei hatte just dieser Senat bereits zwei Jahre zuvor den künstlerischen Leiters des Projekts explizit als Antisemiten enttarnt.
Niemand, wirklich niemand würde sich nachsagen lassen wollen, nicht genug für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund, wie es so schön heißt, zu unternehmen. Am allerwenigsten natürlich staatliche Institutionen und Einrichtungen, denen es bekanntlich ohn’ Unterlass darum zu tun ist, ein friedliches Miteinander zwischen autochthonen Deutschen und den zu ausländischen Mitbürgern objektivierten Einwanderern zu gewährleisten. Kultur gilt in diesem Zusammenhang als ganz besonders geeignet, um Vorurteile abzubauen und für Verständnis zu werben. Also förderte der Berliner Senat von Herzen gerne das Stück „Intifada im Klassenzimmer“ des „Jugendtheaters für Frieden und Gerechtigkeit – gegen Antisemitismus und Islamophobie“ und wies hernach die Kritik, die Darbietung sei selbst antisemitisch, als unbegründet zurück. Dabei hatte just dieser Senat bereits zwei Jahre zuvor den künstlerischen Leiters des Projekts explizit als Antisemiten enttarnt.Die Öffentlichkeit war schwer angetan. Als „schonungslos, offen, teils auch schockierend, auf jeden Fall ehrlich. Sehenswert“ lobte der DGB Berlin-Brandenburg „Intifada im Klassenzimmer“; der beim Landesinstitut für Schule und Medien für den Bereich Demokratieerziehung, Rechtsextremismus und Antisemitismus verantwortliche Michael Rump-Räuber wünschte sich mehr solcher Initiativen, und die SPD zeichnete das Stück sogar als bestes Projekt in der Kategorie Politik mit ihrem Jugendprojektpreis „Goldener Alex 2005“ aus. Aufgeführt wurde es an diversen Stätten Berlins, nicht zuletzt im Rahmen einer Veranstaltung der Bundeszentrale für politische Bildung unmittelbar vor einer Podiumsdiskussion mit den Parlamentariern Lale Akgün (SPD) und Christian Ströbele (Grüne). Anfragen nach Auftritten aus dem ganzen Bundesgebiet und sogar aus Finnland trafen ein, und auch von den Medien gab es positives Feedback. „Gegen Neonazis zu sein, ist nicht genug, wenn die jüdische Mitschülerin ausgeschlossen bleibt. So lautet die Botschaft des Stücks“, befand beispielsweise die Jüdische Allgemeine. Alles eitel Sonnenschein also? Nein. Patrick Neu widersprach in der Jüdischen Zeitung* vehement:
„Wiederholt werden darin Bezüge und Vergleiche zu Nazi-Deutschland und zum Holocaust angestellt, um die Situation von Arabern und Moslems als unter pauschalem Terrorismusverdacht stehenden Opfern im heutigen Deutschland sowie das Handeln Israels gegenüber den Palästinensern und der USA im Irak darzustellen. Bilder aus Vernichtungslagern sowie aus Guantanamo werden auf eine Leinwand hinter der Bühne projiziert und deutliche Analogien zu der Situation von Muslimen und Arabern in Deutschland suggeriert. Sätze wie ‚Panzer im heiligen Land, dann sprengen sich die Menschen in die Luft’ oder ‚Ich bin für die Befreiung Palästinas’ (wobei zu Beginn darauf hingewiesen wird, dass mit Palästina Israel gemeint ist), fallen dabei. Terrorismus wird hingegen verharmlost: ‚Ja, bin für den irakischen Widerstand, und ja, ich bin gegen die US-Herrschaft, ja ich würde lieber kiffen im Kanzleramt. Ja, mein Vater war bei der Hizbollah, aber nein, ich bin kein Terrorist, ... Der größte Terrorist, das bist doch Du.’“Im Grunde genommen verriet bereits der Name des Jugendtheaters – „gegen Antisemitismus und Islamophobie“ –, wohin die Reise gehen sollte. Denn das längst obligatorische, selbstverständliche Platzieren einer Kampfvokabel – mit der jegliche Kritik an den mörderischen Tendenzen und Praxen des Islam unter den Pauschalverdacht des Rassismus gestellt wird – neben den Terminus für die Vernichtungsideologie par excellence hätte eigentlich hellhörig machen müssen. Doch sowohl der rot-rote Berliner Senat als auch das Publikum hatten kein Problem mit dem Stück – zweifellos deshalb, weil sie dessen politische Aussage teilten. Und daher gab es auch keine Einwände, als einer der jugendlichen Schauspieler in einer öffentlichen Diskussion nach einer der Vorführungen im Juni letzten Jahres Klartext sprach: „Früher wurden die Juden vergast – okay schlimm –, aber jetzt sozusagen machen sie das gleiche in Palästina; nicht alle Juden, aber Israelis...“ Eine Position, die bekanntlich eine satte Zweidrittelmehrheit der Deutschen teilt. Und Kindermund tut schließlich Wahrheit kund – warum also widersprechen?
 Die Texte für das Theaterstück stammten übrigens vom künstlerischen Leiter des Projekts, dem britisch-pakistanischen Streetworker Ahmed Shah (Foto). Und der ist kein Unbekannter, wie Patrick Neu zu berichten wusste:*
Die Texte für das Theaterstück stammten übrigens vom künstlerischen Leiter des Projekts, dem britisch-pakistanischen Streetworker Ahmed Shah (Foto). Und der ist kein Unbekannter, wie Patrick Neu zu berichten wusste:*„Die von Shah propagierte Ideologie stellt sich nicht zuletzt in einem Beitrag deutlich dar, den er für einen Sammelband mit dem Titel ‚Israel und der palästinensische Befreiungskampf’ verfasste und der auch auf der Webseite der von ihm mitbegründeten trotzkistischen Organisation ‚Linksruck’ zu finden ist. Darin bezeichnet Shah in knallharter antiimperialistischer Diktion den alltäglichen Terrorismus im Irak als ‚Widerstand gegen die amerikanische Herrschaft in der Region’ und nennt die Palästinenser ‚Opfer des Imperialismus’, welche ‚durch Gewalt zionistischer Terrororganisationen und in Komplizenschaft mit der größten imperialistischen Macht der Welt, den USA, aus ihrer Heimat vertrieben’ wurden. [...] Der israelische Staat, so Shah, sei ein ‚zionistische[r], d.h. rein jüdische[r] [Staat], der auf der Verschmelzung von Religion und Staat beruht, diesen als Heimstätte aller Juden weltweit versteht und allen Juden volle Staatsbürgerrechte garantiert, zugleich aber Palästinensern, die dort geboren sind, ihr Rückkehrrecht versagt’.“Was der Berliner Senat nicht wusste oder nicht wissen wollte, bewog den Abgeordneten Alexander Ritzmann (FDP) im Mai dieses Jahres zu einer Kleinen Anfrage an das Abgeordnetenhaus unter dem Titel „Fördert der Senat antisemitische Jugendprojekte?“, mit der er die Hintergründe für die Unterstützung erhellen und eine Stellungnahme erwirken wollte. In ihrer Antwort verteidigte Staatssekretärin Petra Leuschner (PDS) die Initiative und deren Förderung uneingeschränkt. Antisemitismus konnte oder wollte sie nicht entdecken; stattdessen hielt sie dem Projekt zugute, die „vielfältige[n] Probleme und Lebenserfahrungen der beteiligten Jugendlichen (u.a. mit palästinensischem oder türkischem Migrationshintergrund) in jugendgemäßer Form auf der Bühne dargestellt, problematisiert und der Diskussion zugänglich gemacht“ zu haben – mit anderen Worten: Unter bestimmten Bedingungen ist es pädagogisch wertvoll, die Shoa zu relativieren und die Juden zu den Nazis von heute zu machen. Auch über den Projektleiter Ahmed Shah und dessen antizionistisches und antiamerikanisches Wirken wollte Leuschner nichts Schlechtes sagen; seine „vorgetragenen Argumente“ – „die private Meinungsäußerung eines einzelnen Projektmitarbeiters“ – seien zwar „nicht immer nachvollziehbar“, doch repräsentierten sie weder das Gesamtprojekt noch den Projektträger. Darüber hinaus wurden noch die allfälligen Kronzeugen ausgepackt: Die Jüdische Allgemeine habe schließlich positiv über die Aufführungen berichtet, und im Beirat des Projekts säßen immerhin die Geschäftsführerin des Weltkongresses Russischsprachiger Juden sowie die Vorsitzende der Jugendorganisation der Deutsch-Israelischen Gesellschaft. Das musste für den Koscherstempel reichen.
 Ritzmann gab sich mit diesen Statements jedoch nicht zufrieden und hakte in einer zweiten Kleinen Anfrage Ende Juni noch einmal nach. Heraus kam erwartungsgemäß das Gleiche wie beim ersten Versuch. „Vorurteile, Stereotype, einfache Welterklärungsmuster und Verschwörungstheorien“ kämen „gerade bei Migrantenjugendlichen aus dem arabischen Raum aufgrund ihrer Biografie“ nun einmal vor und seien nur in einem „langwierigen Auseinandersetzungs- und Ablösungsprozess“ zu verändern. „Diesen Weg ist das Projekt gegangen“, bescheinigte Leuschner (Foto) im Namen des Senats dem „Jugendtheater für Frieden und Gerechtigkeit – gegen Antisemitismus und Islamophobie“ erneut gute Arbeit mit seiner „Intifada im Klassenzimmer“. „Eine Ähnlichkeit zwischen jüdischem Staat bzw. den USA und dem Dritten Reich herzustellen ist weder Inhalt noch Absicht des Theaterstücks“, befand die Staatssekretärin; die „Position der Hamas“ werde nicht unterstützt, und auch das Existenzrecht des Staates Israel sei „nicht explizit in Frage gestellt“, selbst wenn die „israelische Regierungspolitik“ einer „unangemessen harten Kritik“ unterzogen werde. Nein, man muss nicht fragen, ob Leuschner oder andere Senatsmitglieder das Stück wirklich gesehen haben – man muss nur um die üblichen antizionistischen Verniedlichungen originär antisemitischer Topoi wissen, die solche Einschätzungen bestimmen, um zu verstehen, warum Projekte wie das Jugendtheater mehrere tausend Euro an Zuwendungen bekommen.
Ritzmann gab sich mit diesen Statements jedoch nicht zufrieden und hakte in einer zweiten Kleinen Anfrage Ende Juni noch einmal nach. Heraus kam erwartungsgemäß das Gleiche wie beim ersten Versuch. „Vorurteile, Stereotype, einfache Welterklärungsmuster und Verschwörungstheorien“ kämen „gerade bei Migrantenjugendlichen aus dem arabischen Raum aufgrund ihrer Biografie“ nun einmal vor und seien nur in einem „langwierigen Auseinandersetzungs- und Ablösungsprozess“ zu verändern. „Diesen Weg ist das Projekt gegangen“, bescheinigte Leuschner (Foto) im Namen des Senats dem „Jugendtheater für Frieden und Gerechtigkeit – gegen Antisemitismus und Islamophobie“ erneut gute Arbeit mit seiner „Intifada im Klassenzimmer“. „Eine Ähnlichkeit zwischen jüdischem Staat bzw. den USA und dem Dritten Reich herzustellen ist weder Inhalt noch Absicht des Theaterstücks“, befand die Staatssekretärin; die „Position der Hamas“ werde nicht unterstützt, und auch das Existenzrecht des Staates Israel sei „nicht explizit in Frage gestellt“, selbst wenn die „israelische Regierungspolitik“ einer „unangemessen harten Kritik“ unterzogen werde. Nein, man muss nicht fragen, ob Leuschner oder andere Senatsmitglieder das Stück wirklich gesehen haben – man muss nur um die üblichen antizionistischen Verniedlichungen originär antisemitischer Topoi wissen, die solche Einschätzungen bestimmen, um zu verstehen, warum Projekte wie das Jugendtheater mehrere tausend Euro an Zuwendungen bekommen.Gleichwohl ist es bemerkenswert, dass eine andere Abteilung des Senats durchaus angemessen zu würdigen wusste, wes Geistes Kind Ahmed Shah ist. In der 2004 veröffentlichten Broschüre „Im Fokus: Antisemitismus“ führte der herausgebende Berliner Verfassungsschutz nämlich just einen Text des Linksruck-Aktivisten als besonders prägnantes Beispiel für die Agitation mit antisemitischen Stereotypen an, mittels derer „Israel mit dem nationalsozialistischen Deutschland verglichen“ und dem jüdischen Staat „die Schuld am wachsenden Antisemitismus gegeben“ wird: „Israel: Bollwerk gegen Antisemitismus?“, betitelte Shah seinen Kommentar in der Linksruck-Zeitung vom 13. Dezember 2000, der in der Schrift des Verfassungsschutzes explizite Erwähnung fand. In dem Beitrag hieß es unter anderem: „Der Staat Israel bezeichnet jeden als Antisemit [sic!], der sich gegen die blutige Unterdrückung der Araber wendet. Dadurch erschwert Israel eine echte Bekämpfung des Antisemitismus. Es erlaubte dem Westen, eine wirkliche Auseinandersetzung mit den [sic!] Antisemitismus und dem Holocaust zu vermeiden. Die Begriffe wurden für Israels Machtinteressen instrumentalisiert.“ Unmittelbar darauf empfahl Shah, sich an die Chomskys und Finkelsteine dieser Welt zu halten, die derlei schließlich selbst äußerten. Mag sein, dass die Staatssekretärin Petra Leuschner die Ausführungen der Berliner Innenbehörde gar nicht kannte, als sie die Anfragen von Alexander Ritzmann beantwortete. Solche Unkenntnis wäre peinlich. Möglich – und wahrscheinlicher – jedoch, dass sie sich bei der Lektüre schlicht dachte: na und? Denn das, was Shah schreibt, ist nicht so weit weg von dem, was Rot-Rot praktiziert – und fördert.
Am Sonntag finden in Berlin Wahlen statt. Man darf gespannt sein, ob der Senat auch anschließend von Parteien gebildet wird, die antisemitische Theaterstücke finanziell ausstatten und politisch verteidigen.
Update 16. September 2006: Was Ahmed Shah nun veranstaltet, nachdem er die „Intifada im Klassenzimmer“ geprobt hat, weshalb er mit seinen Schützlingen KZ-Gedenkstätten aufsucht und wieso am Ende immer „1001 Arabian Opfer“ dabei herauskommen, weiß das Weblog lfodemon.
* Die Beiträge sind nicht auf der Website der Jüdischen Zeitung abrufbar, dafür aber in der Online-Zeitung Die Jüdische. Die Links führen jeweils auf diese Seite.