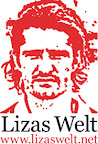Urdeutsche Projektionen
 Mal ehrlich: Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen, die vor kurzem noch nicht mal ahnten, dass hierzulande gerade eine Handball-WM im Gange ist, sich jetzt kollektiv als Weltmeister fühlen? Ist es nicht merkwürdig, dass Leute, die bislang allenfalls ahnten, wie viele Spieler bei diesem Wettkampf zu einer Mannschaft gehören und wie lange eine Partie eigentlich dauert, nun ausgewiesene Experten sind? Ist es nicht grotesk, dass Abertausende, die vor zwei Wochen keinen einzigen deutschen Spieler mit Namen kannten, spätestens seit dem vergangenen Sonntag das Team besser aufstellen zu können glauben als der Trainer? Die urplötzlich entstandene Leidenschaft hat jedenfalls, so viel ist sicher, wenig mit dem Handball als solchem zu tun – für den sich zuvor nur vergleichsweise wenige begeistern konnten –, dafür jedoch umso mehr mit der allfälligen Reaktion auf deutsche Erfolge. Mag sein, dass auch in anderen Ländern aus dem Nichts ein Boom entsteht, wenn in einer vormals kaum beachteten Sportart überraschend Siege für die Einheimischen zu verzeichnen sind; mag zudem sein, dass dem Massentaumel fast überall ein politischer Mehrwert abgepresst wird. Aber die entsprechende Ideologisierung ist in Deutschland stets besonders fulminant. Sie war es bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer, und sie ist es auch jetzt wieder. Und Spiegel-Leser wissen, wie immer, noch ein bisschen mehr.
Mal ehrlich: Ist es nicht erstaunlich, dass Menschen, die vor kurzem noch nicht mal ahnten, dass hierzulande gerade eine Handball-WM im Gange ist, sich jetzt kollektiv als Weltmeister fühlen? Ist es nicht merkwürdig, dass Leute, die bislang allenfalls ahnten, wie viele Spieler bei diesem Wettkampf zu einer Mannschaft gehören und wie lange eine Partie eigentlich dauert, nun ausgewiesene Experten sind? Ist es nicht grotesk, dass Abertausende, die vor zwei Wochen keinen einzigen deutschen Spieler mit Namen kannten, spätestens seit dem vergangenen Sonntag das Team besser aufstellen zu können glauben als der Trainer? Die urplötzlich entstandene Leidenschaft hat jedenfalls, so viel ist sicher, wenig mit dem Handball als solchem zu tun – für den sich zuvor nur vergleichsweise wenige begeistern konnten –, dafür jedoch umso mehr mit der allfälligen Reaktion auf deutsche Erfolge. Mag sein, dass auch in anderen Ländern aus dem Nichts ein Boom entsteht, wenn in einer vormals kaum beachteten Sportart überraschend Siege für die Einheimischen zu verzeichnen sind; mag zudem sein, dass dem Massentaumel fast überall ein politischer Mehrwert abgepresst wird. Aber die entsprechende Ideologisierung ist in Deutschland stets besonders fulminant. Sie war es bei der Fußball-Weltmeisterschaft im Sommer, und sie ist es auch jetzt wieder. Und Spiegel-Leser wissen, wie immer, noch ein bisschen mehr.Als „Sieg der Werte“ feierte in besagtem Wochenmagazin nämlich Achim Achilles den Triumph der Deutschen; „Werdet Handballer!“ lautete dementsprechend seine Aufforderung, denn: „Handball ist bodenständig wie kaum etwas, Deutschland war wie Gummersbach in dieser wundervollen Woche. Kein Marketing-Schnickschnack, kein Fanmeilen-Hype, sondern Fernsehen in stickigen, engen, urwüchsigen Soziotopen.“ Das reinste und ursprünglichste Wohlfühlen also: Ländliche Idylle fernab des kalten und hektischen Molochs namens Großstadt, eine natürliche Nische in der künstlichen Welt des Kapitalismus, ein Unter-sich-Sein in der hermetischen Dorfgemeinschaft ohne störende Fremde, Volks- und Heimattümelei gegen das feindliche Außen; alles ganz romantizistisch-autochthon, eng und vermeintlich widerspruchsfrei. „Und dazu dieses gute Gefühl, nichts geschenkt bekommen zu haben“ – wie dereinst die Trümmerfrauen und Kriegsheimkehrer. Der ideale Nährboden also für echte deutsche Lauterkeiten: „Diese Mannschaft hatte den Sieg verdient wie keine andere. Sie kämpfte, sie ackerte, gab niemals auf.“ Wäre da nicht eine Vorrundenniederlage gewesen, hätte man glatt sagen können: Im Felde unbesiegt.
Was den Handball zusätzlich gegenüber der weitaus beliebteren Lederkugel-Sportart auszeichnen soll, formulierte Achilles am Beispiel des Bundestrainers Heiner Brand: Der sei nämlich „der Prototyp des deutschen Handballers: keine millionenschweren Werbeverträge, kein dröhnendes Vertragsgefeilsche, keine esoterische Philosophie, keine Film- und Foto-Sessions, kein übermächtiger Personenkult.“ Also nix mehr mit unsteten Emporkömmlingen wie Klinsi, Schweini & Poldi, soll das heißen, sondern lieber mit Heini, dem Heimatverwurzelten aus dem Bergischen Land. Denn der ist für Achilles auch und vor allem der prototypische Deutsche: Er „macht einfach nur das, was er kann – seinen Job. Und den macht er gut. Millionen Deutsche sind wie Brand: Ingenieure, Installateure, Briefträger. Keine Genies, sondern Männer im Getriebe. Solider Mittelstand. Jeden Tag aufs Neue halbwegs zuverlässig, ernst, bis zur Langeweile akribisch, aber oftmals erfolgreich“. Solche vermeintlichen oder tatsächlichen „Männer im Getriebe“ – die es wohlgemerkt ölen und nicht mit Sand bestreuen sollen – mochte man in deutschen Landen schon immer besonders gerne: Sie tun die Dinge um ihrer selbst willen, sie leben, um zu arbeiten, und nicht umgekehrt, und sie zetteln keine Skandale an. Kurz: Sie verrichten ihre Pflicht und fragen nicht weiter.
 Und daher gelte: „Weit mehr als das Pop-Business Fußball verkörpern Brand und seine Jungs deutsche Kernwerte.“ Das musste ganz offensichtlich dringend mal raus: „deutsche Kernwerte“, vulgo: Tugenden. Zwei davon sind die Bodenständigkeit und die Treue, die der Spiegel-Autor nachgerade mustergültig bei den deutschen Spielern verwirklicht sieht; hinzu kommt eine veritable Standortromantik: „Einer wie Florian Kehrmann betreibt ein Sportgeschäft, Holger Glandorf, geboren in Osnabrück, hat Speditionskaufmann gelernt. Sie spielen in Flensburg oder Göppingen, in Kiel oder Magdeburg, weder abhängig von russischen Milliardären noch italienischen Halbseidenschals. Zum Sponsorenkreis gehört immer noch der lokale Bauunternehmer.“ Woraus folge: „Handballer versuchen nicht, irgendeine lässig-alberne amerikanische Profi-Mentalität zu imitieren.“ Sondern als kernige deutsche Männer daherzukommen, die Sport noch arbeiten und eine verschworene Gemeinschaft bilden, die niemand trennen kann: „Hat man je die Spielerfrauen der Handballer irgendwo gesehen? Nein. Und das ist gut so.“ Zwar hat man die Genannten sehr wohl deutlich gesehen; beim Finale etwa trugen sie, wie das Fernsehen mehrfach zeigte, T-Shirts mit den Rückennummern ihrer Freunde und Ehemänner. Ganz so unter sich waren die Herren also durchaus nicht, übrigens auch nach dem Endspiel nicht. Aber was kümmert’s den Baum, wenn die Sau sich an ihm reibt und die Botschaft lauten soll: Hier sind noch echte Kerle am Start, rau, unverweichlicht und mit unbändiger Ausdauer.
Und daher gelte: „Weit mehr als das Pop-Business Fußball verkörpern Brand und seine Jungs deutsche Kernwerte.“ Das musste ganz offensichtlich dringend mal raus: „deutsche Kernwerte“, vulgo: Tugenden. Zwei davon sind die Bodenständigkeit und die Treue, die der Spiegel-Autor nachgerade mustergültig bei den deutschen Spielern verwirklicht sieht; hinzu kommt eine veritable Standortromantik: „Einer wie Florian Kehrmann betreibt ein Sportgeschäft, Holger Glandorf, geboren in Osnabrück, hat Speditionskaufmann gelernt. Sie spielen in Flensburg oder Göppingen, in Kiel oder Magdeburg, weder abhängig von russischen Milliardären noch italienischen Halbseidenschals. Zum Sponsorenkreis gehört immer noch der lokale Bauunternehmer.“ Woraus folge: „Handballer versuchen nicht, irgendeine lässig-alberne amerikanische Profi-Mentalität zu imitieren.“ Sondern als kernige deutsche Männer daherzukommen, die Sport noch arbeiten und eine verschworene Gemeinschaft bilden, die niemand trennen kann: „Hat man je die Spielerfrauen der Handballer irgendwo gesehen? Nein. Und das ist gut so.“ Zwar hat man die Genannten sehr wohl deutlich gesehen; beim Finale etwa trugen sie, wie das Fernsehen mehrfach zeigte, T-Shirts mit den Rückennummern ihrer Freunde und Ehemänner. Ganz so unter sich waren die Herren also durchaus nicht, übrigens auch nach dem Endspiel nicht. Aber was kümmert’s den Baum, wenn die Sau sich an ihm reibt und die Botschaft lauten soll: Hier sind noch echte Kerle am Start, rau, unverweichlicht und mit unbändiger Ausdauer.Das riecht nicht nur alles nach Blut, Schweiß und Tränen, das ist auch so gemeint, denn: „Handball in seiner Bodenständigkeit ist ein urdeutscher Sport, dessen hochspannende Inszenierung sich aus dem Spiel selbst heraus entwickelt.“ Und nicht durch irgendeinen Pomp zum Event aufgeblasen wird wie bei den Amis oder seit ein paar Jahren auch im Fußball, soll das vermutlich bedeuten. Kein Wunder: „Die traditionsreichen Clubs wie Gummersbach oder Lemgo liegen in der Peripherie, in Klein- und Mittelstädten, dort, wo zwei Drittel aller Deutschen wohnen, dort, wo die Welt nach den Maßstäben der Normalbürger noch halbwegs in Ordnung ist, dort, wo der Mittelstand zu Hause ist.“ Wo also, folgt man dem Spiegel-Kolumnisten, noch gepflegte Friedhofsruhe herrscht, den Vorgärten jedwede Wucherung streng untersagt ist, abends um zehn die Bürgersteige hochgeklappt werden und Frauen auch im Dunkeln auf die Straße gehen können – kurz: wo es deutsch bis auf die Knochen zugeht, auch und gerade beim Sport: „Ehrliche Fans schätzen ehrliche Kämpfer und brüllen ehrliche Beleidigungen. Auf dem Feld wird solider Fleiß- und Kampfsport geboten, der manchmal auch ins Brachiale spielt. Da kann kein Brasilianer, Argentinier, Italiener mithalten. Viel Dekor, Kabinett und Kabarett stören beim Handball nur.“ Denn als guter Deutscher schätzt man das Unverfälschte und Archaische; am liebsten hätte es Achilles wohl gehabt, wenn die deutschen Spieler im Lendenschurz und mit großen Keulen aufgelaufen wären: „Es ist ja kein Zufall, dass von allen Mannschaftssportlern die Handballer in den hässlichsten Trikots stecken, wie diese deutsche Nationalmannschaft eindrucksvoll bewies. Die Schale ist ihnen eben vergleichsweise wurscht; der metrosexuelle Style-Terror der Großstadt-Weicheier erst recht, die es für intellektuell halten, aus dem Tragen von Flechtslippern Weltbilder zu entwickeln.“ Denn auf dem Dorf und in der Kleinstadt geht es vielleicht ein bisschen hart, dafür aber umso herzlicher, weil einfacher und aufs Wesentliche reduziert, zu: „Über Hierarchie wird entschieden auf dem Platz. Und hinterher an der Theke.“
 Es ist nicht einmal auszuschließen, dass Achilles mit seinem Beitrag tatsächlich den Nerv und die Motivation vieler getroffen hat, die ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen wieder auspackten, in den Hallen den Gegnern der deutschen Mannschaft mit ihrem bornierten Gepfeife zusetzten und in den Kneipen kollektiv das Vaterland hochleben ließen. Wie wenig die nationale Euphorie mit einem tatsächlichen Interesse am Handball zu tun hat, zeigten jedenfalls auch zwei Begebenheiten im Zuge des Endspiels in der KölnArena: Das Fernsehen fing – selbstverständlich unkommentiert – ein überdimensional breites, selbst gemaltes Transparent ein, auf dem, an den Finalgegner Polen gerichtet, geschrieben stand: „Unsere Autos könnt ihr haben, aber der Titel bleibt hier“. Die osteuropäischen Nachbarn der Bundesrepublik als vereinigte Schieberbande – es lebe das Ressentiment! Und auch das Verhalten der Zuschauer während der Siegerehrung sprach Bände: Während der Drittplatzierte mehr als freundlich mit „Dänemark! Dänemark!“-Rufen gefeiert wurde, rührte sich bei der Vergabe der Silbermedaillen an die unterlegenen Polen kaum eine Hand; vereinzelt waren sogar Pfiffe zu hören. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Stimmung gewesen wäre, hätte die Truppe von Trainer Heiner Brand den Weltmeisterpokal nicht gewonnen.
Es ist nicht einmal auszuschließen, dass Achilles mit seinem Beitrag tatsächlich den Nerv und die Motivation vieler getroffen hat, die ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen wieder auspackten, in den Hallen den Gegnern der deutschen Mannschaft mit ihrem bornierten Gepfeife zusetzten und in den Kneipen kollektiv das Vaterland hochleben ließen. Wie wenig die nationale Euphorie mit einem tatsächlichen Interesse am Handball zu tun hat, zeigten jedenfalls auch zwei Begebenheiten im Zuge des Endspiels in der KölnArena: Das Fernsehen fing – selbstverständlich unkommentiert – ein überdimensional breites, selbst gemaltes Transparent ein, auf dem, an den Finalgegner Polen gerichtet, geschrieben stand: „Unsere Autos könnt ihr haben, aber der Titel bleibt hier“. Die osteuropäischen Nachbarn der Bundesrepublik als vereinigte Schieberbande – es lebe das Ressentiment! Und auch das Verhalten der Zuschauer während der Siegerehrung sprach Bände: Während der Drittplatzierte mehr als freundlich mit „Dänemark! Dänemark!“-Rufen gefeiert wurde, rührte sich bei der Vergabe der Silbermedaillen an die unterlegenen Polen kaum eine Hand; vereinzelt waren sogar Pfiffe zu hören. Man mag sich gar nicht vorstellen, wie die Stimmung gewesen wäre, hätte die Truppe von Trainer Heiner Brand den Weltmeisterpokal nicht gewonnen.Ihr selbst tut man vermutlich übrigens Unrecht, wenn man sie, wie Achilles, mit Projektionen bedenkt, die stark an das nationalsozialistische „Zäh wie Leder, hart wie Kruppstahl und flink wie Windhunde“ erinnern. Denn sowohl die Spieler als auch ihr Trainer hätten wohl kaum etwas dagegen, wenn der Handball sich professionalisierte und dadurch größere Sponsoren einstiegen, bessere Gehälter in Aussicht stünden und die Infrastruktur ausgebaut würde. Urdeutsch ist es demgegenüber, den Amateurismus für einen Wert an sich zu halten und das Ideal des Sportlers zu konservieren, der, bitteschön, seinen Körper unentgeltlich zur Mehrung des vaterländischen Ruhms einzusetzen hat und nicht, um damit seinen Lebensunterhalt zu bestreiten oder sich gar Luxus leisten zu können. Schon im deutschen Fußball hielt sich dieser Gedanke der zutiefst antisemitischen Turnerbewegung viel zu lange: Während es andernorts längst Profiligen gab, deren Kicker für ihr Können bezahlt wurden, hielt man diesen Sport hierzulande noch für englische „Fußlümmelei“ und jedenfalls nicht für einen Beruf; die Bundesliga wurde im europäischen Vergleich dementsprechend extrem spät, nämlich erst 1963, gegründet. Sollte der Handball – was allerdings nicht sehr wahrscheinlich ist – einen ähnlichen Popularisierungsschub inklusive der damit zusammenhängenden Entwicklung erfahren, wäre das für Achilles und seine Anhänger vermutlich so eine Art Vaterlandsverrat.
Was der Spiegel-Kolumnist hier verfasst hat, ist deutsche Ideologie in Reinkultur. Denn wenn völlig affirmativ von „deutschen Kernwerten“ die Rede ist, die darin bestehen sollen, in „stickigen, engen, urwüchsigen Soziotopen“ zu leben, aufopferungsvoll für die Sache zu kämpfen und niemals aufzugeben – die Dinge also um ihrer selbst willen zu tun und nicht für Geld –, Bodenständigkeit, Fleiß und Heimatverbundenheit als Tugenden zu preisen und ehrliche, harte körperliche Arbeit als Nonplusultra zu verehren – dann ist das eine Kampfansage an all das, was seit jeher als undeutsch gilt: Urbanität und Kosmopolitismus, Mobilität und Weltläufigkeit, Faulheit und Hedonismus, Individualität und eigenes Fortkommen. All dies wird vom Antisemitismus bekanntlich auf Juden projiziert, und auch wenn Achilles das nicht explizit tut, ist sein Beitrag von genau diesen Ressentiments durchtränkt. Ersatzweise zieht er gegen die „lässig-alberne amerikanische Profi-Mentalität“, „russische Milliardäre“ oder „italienische Halbseidenschals“ vom Leder, spricht vom „metrosexuellen Style-Terror der Großstadt-Weicheier“ und rühmt den brachialen Kampf seiner Landsleute bis zum Letzten: „Da kann kein Brasilianer, Argentinier, Italiener mithalten.“ Kurt Tucholsky bemerkte dereinst: „Nie geraten die Deutschen so außer sich, wie wenn sie zu sich kommen wollen.“ Achilles jedenfalls ist schon dort – und dabei längst nicht ohne Gesellschaft.