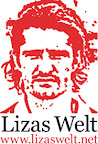Antizionismus für Kinder
 Baden-Württemberg ist ein friedfertiges Bundesland. Praktisch niemand will dort etwas Böses, man geht höflich miteinander um, pflegt verschiedene Mundarten, die allesamt wenig aggressiv daherkommen, ist redlich, ökologisch und fromm, steigert das Bruttosozialprodukt und hält es je nachdem mit dem VfB Stuttgart oder dem SC Freiburg, die ebenfalls noch nie jemandem ernstlich weh getan haben. Kein Wunder deshalb auch, dass die Fußballmannschaft des Iran ihr Quartier am Bodensee bezogen hat und dort freundlich empfangen worden ist. Denn die so genannte Friedensbewegung hatte zwischen Freudenberg und Konstanz, zwischen Kehl und Dischingen immer wahre Hochburgen, und wer erinnert sich nicht an den perlenden Wortwitz der Marke „Mutlangen, unser Mut wird langen“ im Zuge naiv-kindlicher und also deutscher Achtziger-Jahre-Proteste gegen den alliierten Bombenterror, Verzeihung: die Nachrüstung und US-amerikanische Mittelstreckenraketen? In diesem süddeutschen Landstrich hat es auch ein beschauliches Städtchen namens Tübingen, das nicht nur über eine als intellektuell beleumundete Universität verfügt, sondern auch ein Friedensplenum/Antikriegsbündnis und eine Informationsstelle Militarisierung (IMI) beheimatet – wie es sich gehört, sind beide eingetragene Vereine – und ein Institut für Friedenspädagogik vorweisen kann, das ebenfalls amtlich als gemeinnützig registriert ist und seine Ziele so umreißt:
Baden-Württemberg ist ein friedfertiges Bundesland. Praktisch niemand will dort etwas Böses, man geht höflich miteinander um, pflegt verschiedene Mundarten, die allesamt wenig aggressiv daherkommen, ist redlich, ökologisch und fromm, steigert das Bruttosozialprodukt und hält es je nachdem mit dem VfB Stuttgart oder dem SC Freiburg, die ebenfalls noch nie jemandem ernstlich weh getan haben. Kein Wunder deshalb auch, dass die Fußballmannschaft des Iran ihr Quartier am Bodensee bezogen hat und dort freundlich empfangen worden ist. Denn die so genannte Friedensbewegung hatte zwischen Freudenberg und Konstanz, zwischen Kehl und Dischingen immer wahre Hochburgen, und wer erinnert sich nicht an den perlenden Wortwitz der Marke „Mutlangen, unser Mut wird langen“ im Zuge naiv-kindlicher und also deutscher Achtziger-Jahre-Proteste gegen den alliierten Bombenterror, Verzeihung: die Nachrüstung und US-amerikanische Mittelstreckenraketen? In diesem süddeutschen Landstrich hat es auch ein beschauliches Städtchen namens Tübingen, das nicht nur über eine als intellektuell beleumundete Universität verfügt, sondern auch ein Friedensplenum/Antikriegsbündnis und eine Informationsstelle Militarisierung (IMI) beheimatet – wie es sich gehört, sind beide eingetragene Vereine – und ein Institut für Friedenspädagogik vorweisen kann, das ebenfalls amtlich als gemeinnützig registriert ist und seine Ziele so umreißt:„Ein zentrales Anliegen [...] ist es, Friedenserziehung durch ein Angebot fundierter Materialien, Bildungsangebote und Beratung in der Gesellschaft zu verankern und Zugänge in alltägliche Bildungszusammenhänge zu eröffnen.“Zu diesen „fundierten Materialien“, die „alltägliche Bildungszusammenhänge eröffnen“ sollen, wie es in grausamstem Pädagogendeutsch heißt, gehört der Webauftritt frieden-fragen.de, nach eigener Auskunft ein „Internet-Angebot für Kinder, Eltern und ErzieherInnen, das zu Fragen von Krieg und Frieden informiert und einen Austausch zu diesem Themenbereich ermöglicht“. Da lohnt sich doch einen näherer Blick darauf, was da im einzelnen so ausgetauscht wird. Immerhin gerät das Ganze ja in Kinderhände – doch man braucht nicht lange, um resümieren zu können, dass für die kindgerechte Beantwortung nicht unkomplexer Sachverhalte wie „Krieg“ und „Frieden“ Erwachsene herangezogen wurden, deren Horizont den eines Siebtklässlers nur unwesentlich überschreitet und die insofern tatsächlich auf Augenhöhe agieren. Die Uno und das Völkerrecht werden bei ihnen als vorbildliche Regulationsinstanzen gehandelt, und man weiß auch, dass Krieg „in den Köpfen der Menschen“ beginnt. „Kann ein Krieg auch zu uns kommen?“ Eher nicht, denn „die meisten Länder in Europa haben gelernt, dass sie ihre Streitigkeiten nicht mit Waffen, sondern durch Gespräche und Verhandlungen lösen“, ganz im Gegensatz etwa zu – na? – den USA und Israel. Erstere ist beispielsweise schuld daran, dass das geläuterte Deutschland immer noch nicht ganz entmilitarisiert ist: „Die amerikanische Armee hat in Deutschland an zwei Orten Atomwaffen gelagert [...] Diese Atomwaffen gehören den ‚Amerikanern’, und nur sie können darüber verfügen.“ Die verschämten Anführungszeichen kaschieren nur unwesentlich, dass man sich im Grunde immer noch besetzt fühlt und sich von diesem gewalttätigen Pack schon lange nichts mehr sagen lassen will.
 Zumal man immer lauter darauf besteht, dass das mit den Nazis zwar zugegeben nicht so der Brüller war, die anderen aber auch die Späne fliegen ließen, denn: „Leider ist es [...] so, dass auch in ‚gut gemeinten’ Kriegen Menschen getötet und Sachen zerstört werden.“ Knapp daneben ist schließlich auch vorbei, weshalb man auf diese nicht mal besonders subtile Art und Weise den Alliierten vorwirft, die Nazis nicht mit Kerzen, sondern mit dem Militär zur Aufgabe gedrängt zu haben. Dennoch sind für die Friedensdidaktiker noch lange nicht alle Kriege gleich: Die einen wollen halt erobern, und wieder andere sind „mit der Regierung nicht einverstanden und versuchen so, selbst die Macht über das Land zu bekommen. Manche Gruppen kämpfen auch darum, ein eigenes Land zu bekommen. Das wollen zum Beispiel die Palästinenser in Israel.“ Jawohl, in Israel! Denn: Sie „kämpfen um ihr Lebensrecht als Volk und für das Recht auf einen eigenen Staat“. Das klingt nicht nur nach Blut & Boden, das ist es auch.
Zumal man immer lauter darauf besteht, dass das mit den Nazis zwar zugegeben nicht so der Brüller war, die anderen aber auch die Späne fliegen ließen, denn: „Leider ist es [...] so, dass auch in ‚gut gemeinten’ Kriegen Menschen getötet und Sachen zerstört werden.“ Knapp daneben ist schließlich auch vorbei, weshalb man auf diese nicht mal besonders subtile Art und Weise den Alliierten vorwirft, die Nazis nicht mit Kerzen, sondern mit dem Militär zur Aufgabe gedrängt zu haben. Dennoch sind für die Friedensdidaktiker noch lange nicht alle Kriege gleich: Die einen wollen halt erobern, und wieder andere sind „mit der Regierung nicht einverstanden und versuchen so, selbst die Macht über das Land zu bekommen. Manche Gruppen kämpfen auch darum, ein eigenes Land zu bekommen. Das wollen zum Beispiel die Palästinenser in Israel.“ Jawohl, in Israel! Denn: Sie „kämpfen um ihr Lebensrecht als Volk und für das Recht auf einen eigenen Staat“. Das klingt nicht nur nach Blut & Boden, das ist es auch.Und falls mal jemand fragen sollte – wie „Cilem, 16 Jahre“ alt und damit ganz allmählich wohl in der Lage, auch umfangreichere Angelegenheiten zu erfassen –, wie lange denn der „Krieg in Palästina“ schon dauere, bekommt zur Antwort: „Die Probleme in Israel nennt man Nahost-Konflikt.“ So einfach kann das sein, wenn man nur simpel genug strukturiert ist, diese Eigenschaft jedoch als Abstraktionsvermögen verkauft, das wiederum spätestens bei seiner Konkretwerdung zur Ideologie gerinnt. Als Beleg mögen hier pädagogisch zurecht gemachte Berichte von „palästinensischen Schülerinnen und Schüler der Schule Thalita Kumi über ihre alltäglichen Erfahrungen mit Krieg und Gewalt“ genügen. Die vierzehnjährige Nadia Kalilieh etwa beschreibt ihr „Leben in Palästina“ so:
„Das ist unser Land, aber wir können nicht einfach fahren, wohin wir wollen. Zum Beispiel, wenn wir nach Jerusalem fahren wollen, müssen wir 2 Stunden fahren. Aber ohne Barriere auf diesem Weg bräuchten wir nur 15 Minuten.“Über die Gründe dafür, dass die Fahrt in die israelische Hauptstadt 120 Minuten dauert statt einer Viertelstunde, erfährt man nichts: nichts darüber, dass die hier als „Barriere“ bezeichneten Kontrollen schon so manches (Selbst-) Mordattentat verhindert haben, nichts über die antisemitischen Vernichtungsdrohungen und -anschläge, nichts über die unhintergehbare Sehnsucht einer veritablen Mehrheit in den Autonomiegebieten nach ganz Palästina. Stattdessen geißelt Nadia lieber den Schutzwall:
„Mit der Mauer ist es wie ein großes Gefangensetzen. Die Mauer trennt unsere Länder. Wir protestieren, aber sie wird gebaut. Diese Mauer ist ungerecht und terrorisiert uns. Alle Weltkinder haben Träume. Palästinakinder haben Alpträume.“
 Die armen Geschöpfe, die unter dem Besatzungsterror leiden. Kinder sind bekanntlich nach der Wahrheit die zweiten Opfer eines jeden Krieges. Wer diesen angezettelt hat und weiter befeuert, wer eine islamistische Partei an die Regierung gewählt hat, die Israel nichts als Tod und Verderben wünscht, wer dafür verantwortlich ist, dass Trennzäune notwendig wurden, die den „Palästinakindern“ schlaflose Nächte bereiten – kein Sterbenswörtchen davon. Bloß ungeschminkter Antizionismus, den man gar nicht früh genug verabreicht bekommen kann, geht es nach dem Institut für Friedenspädagogik. Auch die weiteren zitierten Kinder – Lina (14), Lina (15) und Mariam (14) – berichten dementsprechend von niederträchtigen Angriffen des Israelis, von Ausgangssperren, Schüssen, Panzern, geschlossenen Schulen und Schikanen. Aber sie „hoffen, wie viele andere Kinder und Jugendliche im Nahen Osten, auf eine friedlichere Zukunft“. Was das heißt, erschließt sich recht unmittelbar aus dem Gesagten: das, was nicht nur Mahmud Ahmadinedjad sich unter einer „Welt ohne Zionismus“ vorstellt.
Die armen Geschöpfe, die unter dem Besatzungsterror leiden. Kinder sind bekanntlich nach der Wahrheit die zweiten Opfer eines jeden Krieges. Wer diesen angezettelt hat und weiter befeuert, wer eine islamistische Partei an die Regierung gewählt hat, die Israel nichts als Tod und Verderben wünscht, wer dafür verantwortlich ist, dass Trennzäune notwendig wurden, die den „Palästinakindern“ schlaflose Nächte bereiten – kein Sterbenswörtchen davon. Bloß ungeschminkter Antizionismus, den man gar nicht früh genug verabreicht bekommen kann, geht es nach dem Institut für Friedenspädagogik. Auch die weiteren zitierten Kinder – Lina (14), Lina (15) und Mariam (14) – berichten dementsprechend von niederträchtigen Angriffen des Israelis, von Ausgangssperren, Schüssen, Panzern, geschlossenen Schulen und Schikanen. Aber sie „hoffen, wie viele andere Kinder und Jugendliche im Nahen Osten, auf eine friedlichere Zukunft“. Was das heißt, erschließt sich recht unmittelbar aus dem Gesagten: das, was nicht nur Mahmud Ahmadinedjad sich unter einer „Welt ohne Zionismus“ vorstellt.Doch selbstverständlich – das gehört bei solchen Institutionen zum automatisierten Repertoire – versucht man dem denkbaren Vorwurf der Einseitigkeit zu entgehen, der, bei Lichte betrachtet, allerdings völlig fehl am Platz wäre, weil es vielmehr darum zu gehen hätte, Partei für die andere Seite, für Israel, zu ergreifen, auch deshalb, weil das die Alpträume der Kinder weit eher verschwinden ließe als der Support von Hamas, Fatah & Co. Doch weil man sich äquidistant gerieren will, wo eine propalästinensische Position längst offensichtlich geworden ist, kündigt man an: „Bald könnt Ihr auch Berichte von israelischen Schülerinnen und Schülern lesen, die für ‚frieden-fragen’ schreiben werden.“ Diese Ankündigung steht dort, so fand eine Leserin der Institutsseite heraus, seit fast einem Jahr; bis heute wartet man vergeblich darauf, dass auch die Ängste israelischer Kinder etwa vor palästinensischen Selbstmordattentätern zur Sprache kommen. Zufall? Wohl kaum. Aber vielleicht ist es auch besser so, nicht lesen zu müssen, welche Stimmen die Tübinger Friedensfreunde tatsächlich unter den befragten israelischen Kids auswählen würden. Den geistigen Nachwuchs der Avnerys, Langers und Warschawskis vermutlich.
Fotos (aus Ramallah): Julia, Hattips: Doro & Si Vis Pacem, Para Bellum