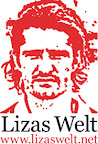Das Odeur der Politologik
 Ja, Achtundsechzig, da war noch richtig was los. „Unter den Talaren Muff von tausend Jahren“ – mit diesem nachgerade lyrischen Slogan zog der akademische Nachwuchs seinerzeit gegen die universitären Autoritäten zu Felde, die es an deutschen Hochschulen weiterhin recht bequem hatten, weil sie nie für ihren Anteil an Judenmord und Vernichtungskrieg zur Rechenschaft, geschweige denn zur Verantwortung gezogen worden waren. Inzwischen geht es an den weiterführenden Bildungseinrichtungen weit gemächlicher zu, und die bunten Röcke werden von den Professoren gewöhnlich nur noch anlässlich der „Eröffnung des akademischen Jahres“ getragen, auf die man in einigen sich elitär dünkenden Lehranstalten noch gewissen Wert legt, sowie von manchen Absolventen, die den Mummenschanz für einen Stoff gewordenen Beweis ihrer Doktorwürde halten. Grund, mal wieder auf die Barrikaden zu gehen, gäbe es gleichwohl genug – und dabei könnte man sogar das Transparent mit dem eingangs zitierten Reim noch einmal entmotten.
Ja, Achtundsechzig, da war noch richtig was los. „Unter den Talaren Muff von tausend Jahren“ – mit diesem nachgerade lyrischen Slogan zog der akademische Nachwuchs seinerzeit gegen die universitären Autoritäten zu Felde, die es an deutschen Hochschulen weiterhin recht bequem hatten, weil sie nie für ihren Anteil an Judenmord und Vernichtungskrieg zur Rechenschaft, geschweige denn zur Verantwortung gezogen worden waren. Inzwischen geht es an den weiterführenden Bildungseinrichtungen weit gemächlicher zu, und die bunten Röcke werden von den Professoren gewöhnlich nur noch anlässlich der „Eröffnung des akademischen Jahres“ getragen, auf die man in einigen sich elitär dünkenden Lehranstalten noch gewissen Wert legt, sowie von manchen Absolventen, die den Mummenschanz für einen Stoff gewordenen Beweis ihrer Doktorwürde halten. Grund, mal wieder auf die Barrikaden zu gehen, gäbe es gleichwohl genug – und dabei könnte man sogar das Transparent mit dem eingangs zitierten Reim noch einmal entmotten.Denn der „Muff von tausend Jahren“ weht immer noch oder doch zumindest immer wieder mal durch die Gänge der Hörsäle und Studienräume, und manchmal entsteigt er auch der Druckerschwärze einer überregionalen Tageszeitung, wie gestern beispielsweise, als die Frankfurter Rundschau das „Manifest der 25“ bringen zu sollen meinte – das Werk einer nämlichen Zahl deutscher Politologen, die sich unter der Losung „Freundschaft und Kritik“ darüber auslassen, „warum die ‚besonderen Beziehungen’ zwischen Deutschland und Israel überdacht werden müssen“. Das Papier hat dabei alles zu bieten, was den modernen Antizionismus ausmacht, sowohl hinsichtlich seines Duktus’ als auch in Bezug auf die Ideologeme, die es bedient. Es Satz für Satz zu prüfen und zu kommentieren, müsste im Grunde genommen das Anliegen von Immatrikulierten und Gelehrten sein, die aufgehört haben zu studieren respektive zu forschen und sich dafür ans Denken gemacht haben – was nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als dass diese Aufgabe im akademischen Bereich mutmaßlich unerledigt bleiben wird. Dabei böte das Manifest Stoff für ein ganzes Hauptseminar oder notfalls zumindest für ein Teach-in.
Beginnend mit einem Zitat der israelischen Außenministerin Tzipi Livni, die die Beziehungen zwischen Israel und Deutschland als „besondere“ und „freundschaftliche“ qualifizierte, begeben sich die Autoren zunächst an eine Bestandsaufnahme: Dieses Besondere sei „auf der deutschen Seite“ durch die „Ungeheuerlichkeit des Holocaust“ und durch die „prekäre Lage Israels“ gekennzeichnet, woraus man hierzulande folgere, sich „uneingeschränkt für Existenz und Wohlergehen dieses Landes und seiner Bevölkerung einzusetzen, unter anderem durch Lieferung von staatlich geförderter hochwertiger Waffentechnologie auch dann, wenn Israel gegen internationales Recht und die Menschenrechte verstößt und sich im Kriegszustand befindet“. Das finden friedensbewegte Politologen schon schlimm genug, aber für noch ärger halten sie qua Profession dies: „Kritik an israelischen Handlungsweisen sollte, wenn überhaupt, nur äußerst verhalten geäußert werden und besser unterbleiben, solange die Existenz dieses Landes nicht definitiv gesichert ist.“ Bereits bei der Inventur gelingt es den Damen und Herren Politikwissenschaftlern also, die Bilanz zu fälschen – denn keine Zeitungslektüre, kein Studium von Umfragen und noch nicht einmal die allabendliche Stunde vor der Glotze lehrt sie, dass sie und ihre Landsleute in Bezug auf den jüdischen Staat längst ungehemmt nach dem Motto verfahren: Wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Und deshalb „diskutieren“ die Buchhalter im Folgenden auch nicht die selbst gestellten „drei Fragen“, weil es sich – ein beliebtes akademisches Spielchen – ohnehin nur um rhetorische handelt, deren Antworten natürlich längst feststehen:
„1. Ist es angemessen und sinnvoll, die ‚freundschaftliche Beziehung’ – und das soll sie nach Auffassung der Autoren bleiben – weiterhin als ‚besondere’ im angedeuteten Sinne zu pflegen? 2. Steht Deutschland aufgrund des Holocaust wirklich nur bei Israel in der Pflicht im Nahen Osten? 3. Und was bedeutet es für den binnendeutschen Diskurs, für die Beziehungen zwischen nicht-jüdischen, jüdischen und muslimischen Deutschen, wenn diese beiden Fragen ernsthaft gestellt werden?“Bevor sie zur Tat schreiten, warten die Verfasser noch mit einer Art Disclaimer auf: Es stehe selbstverständlich „nicht in Frage“, dass „angesichts der weltweit historischen Einzigartigkeit des Holocaust das Verhältnis der nicht-jüdischen Deutschen zu Juden, zu allen, die sich als solche verstehen, ein einmaliges ist, das von besonderer Zurückhaltung und besonderer Sensibilität geprägt sein muss“ – man hat schließlich nichts gegen Juden und zählt sogar welche zu seinen besten Freunden, auch wenn die manchmal ein bisschen empfindlich sind –, „und dass uns nichts von der Verpflichtung entbinden kann“ – auch wenn das manchmal ganz praktisch wäre, weil derlei Obligationen ganz schön anstrengend sein können –, „dem religiösen Antijudaismus und dem ethnisch oder/und rassistisch motivierten Antisemitismus entschieden entgegenzutreten, wo immer er auftritt“. Geschafft – damit wären der islamistische Judenhass und der linke Antisemitismus schon mal außen vor; schließlich sind beides nur Erfindungen von Rassisten respektive Kommunistenfressern.
 Also nichts wie rein ins Getümmel, und zwar mit Kopfsprung: „Auf der zwischenmenschlichen Ebene gilt zweifellos: Eine tragfähige Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Freunde oder Freundinnen einander aus Sorge um das Wohlergehen des anderen auch vor Fehlern, Fehlentscheidungen und Fehlhaltungen warnen.“ Neu ist diese Masche zwar nicht, aber immer noch der letzte Schrei der „Israel-Kritiker“: Wer sich selbst für einen „Freund“ hält, kann niemals Böses im Schilde führen, sondern meint es stets nur gut und will „zu seinem oder ihrem (auch geistigen und moralischen) Wohlergehen“ beitragen, weil sich „die Freundschaft dadurch weiter vertiefen“ wird. Und das auch dann, „wenn einer der beiden dem Anderen gegenüber eine tiefe und zurückliegende Schuld abzutragen hat“. Zeit heilt schließlich alle Wunden. Und deshalb hätte die israelische Regierung ihre tragfähigen deutschen Freunde vor dem Krieg gegen die Hizbollah besser mal „über ihre geplanten Reaktionen informiert“ – als da aus politologischer Sicht waren:
Also nichts wie rein ins Getümmel, und zwar mit Kopfsprung: „Auf der zwischenmenschlichen Ebene gilt zweifellos: Eine tragfähige Freundschaft zeichnet sich dadurch aus, dass Freunde oder Freundinnen einander aus Sorge um das Wohlergehen des anderen auch vor Fehlern, Fehlentscheidungen und Fehlhaltungen warnen.“ Neu ist diese Masche zwar nicht, aber immer noch der letzte Schrei der „Israel-Kritiker“: Wer sich selbst für einen „Freund“ hält, kann niemals Böses im Schilde führen, sondern meint es stets nur gut und will „zu seinem oder ihrem (auch geistigen und moralischen) Wohlergehen“ beitragen, weil sich „die Freundschaft dadurch weiter vertiefen“ wird. Und das auch dann, „wenn einer der beiden dem Anderen gegenüber eine tiefe und zurückliegende Schuld abzutragen hat“. Zeit heilt schließlich alle Wunden. Und deshalb hätte die israelische Regierung ihre tragfähigen deutschen Freunde vor dem Krieg gegen die Hizbollah besser mal „über ihre geplanten Reaktionen informiert“ – als da aus politologischer Sicht waren:„Zerstörung eines Großteils der Infrastruktur des Libanon inkl. der Wasser-, Elektrizitäts- und Ölversorgung sowie des Tourismus durch einen Ölteppich vor der Küste, Vertreibung der Bevölkerung aus dem Südlibanon, bewusste Inkaufnahme hoher ziviler Opfer, um wenigstens eine militärische Schwächung – wenn schon nicht eine Entwaffnung – der Hizbollah zu erreichen, Verweigerung humanitärer Korridore zur Versorgung derjenigen, die nicht fliehen konnten, vollständige Zerstörung der Schiitenviertel in den libanesischen Städten, wochenlange Blockade der Küste und der Flughäfen und Einsatz von Streubomben.“Ganz schön lang, das Sündenregister; fast ist man bei den Manifestlern geneigt, die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt zu sehen. Aber bevor es so weit kommt, ermahnen sie den Kumpel ein letztes Mal zuvorkommend und stehen ihm mit Rat und Tat zur Seite: „Vielleicht wäre es der deutschen Regierung eher als der israelischen möglich gewesen, die katastrophalen weltweiten Folgen einer solchen ‚massiven Vergeltung’ nach dem Prinzip der Kollektivhaftung einzuschätzen?“ Nach Auschwitz weiß man schließlich gerade als Deutscher, wo der Bartel den Most holt, sprich: was Sippenhaftung – dieses Wort hat man aus lauter Rücksichtnahme höflich vermieden – bedeutet. Schade also um die vertane Chance, schade darum, „was ‚Freundschaft’ in einem solchen Falle auch hätte bedeuten können“, wenn sie nicht „weiterhin als ‚besondere’ im eingangs bezeichneten Sinne verstanden“ worden wäre. Denn: „Befreit man sich von dieser Vorstellung, liegt es auf der Hand, dass es sowohl für Israel als auch für Deutschland von Vorteil wäre, eine belastungsfähige Freundschaft zu entwickeln, in der auch Kritik in unterstützender, nicht abwertender Absicht ihren Platz hat.“ Noch einmal schade also – schade, dass die Shoa immer noch eine Belastung für eine „belastungsfähige Freundschaft“ ist, die Befreiung der Deutschen verhindert und überdies „auch das Verhältnis Israels zur EU, zu den USA usw.“ nicht verändert, obwohl das doch „in keinem dieser Fälle zum Schaden der Beteiligten sein würde“.
Und damit zur „deutschen Verantwortung gegenüber Palästina“; schließlich gibt es „eine viel zu selten bedachte Seite der Holocaust-Folgen“: Bis die Nazis kamen, strömten nur 160.000 Juden nach Palästina, und die waren noch nett und freundlich zu den Autochthonen. „Erst durch die früh erkennbare radikale Bedrohung der Juden im nationalsozialistischen Einflussbereich“ – so heißt eliminatorischer Antisemitismus auf Politologisch – „kam es zu einer die Balance mit den Arabern gefährdenden Masseneinwanderung“, und man ahnt schon, was folgt: „Es ist der Holocaust, der das seit sechs Jahrzehnten anhaltende und gegenwärtig bis zur Unerträglichkeit gesteigerte Leid über die (muslimischen wie christlichen und drusischen) Palästinenser gebracht hat.“ Es ist müßig, die Hochschullehrer daran zu erinnern, dass die Nazis die Shoa auch im damaligen Palästina ins Werk setzen wollten und dafür tatkräftige Unterstützung erhielten, weil der Antisemitismus bereits lange vor dem Zweiten Weltkrieg im Nahen Osten angekommen war. Denn die Palästinenser sollen nicht nur die Juden von heute, sondern auch die von gestern sein, die eigentlichen Opfer der Shoa nämlich; schließlich dauerte das Tausendjährige Reich nur zwölf Jahre, aber Israel gibt es schon fast fünf Mal so lange. Starker Tobak? Mitnichten. Zwar ist es bedauerlicherweise „nicht dasselbe, als hätte das Dritte Reich einen Völkermord an den Palästinensern verübt“, immerhin jedoch das Gleiche: „Aber zahllose Tote waren auch hier die Folge, das Auseinanderreißen der Familien, die Vertreibung oder das Hausen in Notquartieren bis auf den heutigen Tag.“
 Noch einmal zur Erinnerung: Zu Beginn des Papiers war von der „weltweit historischen Einzigartigkeit des Holocaust“ die Rede. Aber das war vielleicht ganz anders gemeint, nämlich eher so: „Ohne den Holocaust an den Juden würde die israelische Politik sich nicht berechtigt oder/und gezwungen sehen, sich so hartnäckig über die Menschenrechte der Palästinenser und der Bewohner Libanons hinwegzusetzen, um seine Existenz zu sichern.“ So sieht echter Antifaschismus aus! Doch damit nicht genug: „Ohne den Holocaust erhielte Israel dafür nicht die materielle und politische Rückendeckung der USA, wie sie sich v.a. seit den neunziger Jahren entwickelt hat. (Die amerikanische Finanzhilfe an Israel beläuft sich auf 3 Mrd. US-Dollar jährlich und entspricht damit 20 Prozent der gesamten Auslandsfinanzhilfe der USA.)“ Und schließlich: „Die palästinensische Bevölkerung hat an der Auslagerung eines Teils der europäischen Probleme in den Nahen Osten nicht den geringsten Anteil.“ Das liest sich nicht nur so, als sei es direkt bei Mahmud Ahmadinedjad abgeschrieben, das ist exakt seine Vision von einer „World without Zionism“, übersetzt von einem Haufen antiimperialistischer Seminarverwalter, die „als Deutsche, Österreicher und Europäer“ glauben, „auch eine Mitverantwortung für die Lebensbedingungen und eine selbstbestimmte Zukunft des palästinensischen Volkes“ einklagen zu sollen, „nachdem die Geschichte nun einmal diesen Gang genommen“, sprich: den kleinen Satan Israel hervorgebracht hat.
Noch einmal zur Erinnerung: Zu Beginn des Papiers war von der „weltweit historischen Einzigartigkeit des Holocaust“ die Rede. Aber das war vielleicht ganz anders gemeint, nämlich eher so: „Ohne den Holocaust an den Juden würde die israelische Politik sich nicht berechtigt oder/und gezwungen sehen, sich so hartnäckig über die Menschenrechte der Palästinenser und der Bewohner Libanons hinwegzusetzen, um seine Existenz zu sichern.“ So sieht echter Antifaschismus aus! Doch damit nicht genug: „Ohne den Holocaust erhielte Israel dafür nicht die materielle und politische Rückendeckung der USA, wie sie sich v.a. seit den neunziger Jahren entwickelt hat. (Die amerikanische Finanzhilfe an Israel beläuft sich auf 3 Mrd. US-Dollar jährlich und entspricht damit 20 Prozent der gesamten Auslandsfinanzhilfe der USA.)“ Und schließlich: „Die palästinensische Bevölkerung hat an der Auslagerung eines Teils der europäischen Probleme in den Nahen Osten nicht den geringsten Anteil.“ Das liest sich nicht nur so, als sei es direkt bei Mahmud Ahmadinedjad abgeschrieben, das ist exakt seine Vision von einer „World without Zionism“, übersetzt von einem Haufen antiimperialistischer Seminarverwalter, die „als Deutsche, Österreicher und Europäer“ glauben, „auch eine Mitverantwortung für die Lebensbedingungen und eine selbstbestimmte Zukunft des palästinensischen Volkes“ einklagen zu sollen, „nachdem die Geschichte nun einmal diesen Gang genommen“, sprich: den kleinen Satan Israel hervorgebracht hat.Und „mit Geldtransfer allein ist es jedenfalls nicht getan“ – her muss „ein ökonomisch lebensfähiges Palästina mit ungehinderter Bewegungsfreiheit zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland [...], kein Staat zweiter Klasse, kein Homeland, kein zerstückeltes Bantustan“. Das wiederum könnte direkt aus der Feder der Hamas stammen, doch die Politologen wären keine Deutschen (respektive Österreicher und Europäer), wenn sie nicht auch diesem Vorwurf präventiv entgegentreten und dabei eindrucksvoll unter Beweis stellen würden, dass sie ihre Hätschelkinder als unmündige Lebewesen betrachten, die man für nichts verantwortlich machen kann: „Klar ist auch, dass jede Anstrengung unternommen werden muss, um den Anreiz für Palästinenser zu verringern, sich an mörderischen Attentaten und Raketenangriffen auf israelische Zivilisten zu beteiligen bzw. den Anreiz zu erhöhen, sich an konstruktiver Aufbauarbeit zu beteiligen.“ Derlei „Anstrengung“ und „Anreiz“ hätten die Friedensfreunde bereits im einseitigen Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen erkennen können, doch sie ficht weder das noch die Tatsache an, dass palästinensische Terrororganisationen zum Dank seitdem mehr als 1.000 Kassam-Raketen auf Städte in Israel geschossen haben – und weiter aufrüsten. Lieber appellieren die Urheber des Manifests an das richtige Verständnis der Religion des Friedens: „Europäische Muslime könnten mit entsprechender Unterstützung dazu beitragen, dass auch in Palästina diejenigen islamischen Grundwerte mehr Aufmerksamkeit finden, die den Selbstmordattentaten, die ja nicht von Muslimen erfunden wurden, entgegenstehen, und dass islamische Vorbilder gewaltfreien Widerstands gegen staatliches Unrecht bekannt und anerkannt werden.“ Gesucht wird also eine Art muslimischer Gandhi – viel Glück auch!
Was folgt, ist das nicht nur in Politologenkreisen obligatorische Plädoyer für eine Äquidistanz, die so wenig originell wie mörderisch ist: „Nicht nur die militaristischen Gruppen der Palästinenser und die Hizbollah haben mit ihren Raketenangriffen und den fortgesetzten Selbstmordattentaten den Geist von Oslo zerstört; die völkerrechtswidrige Fortsetzung und der massive Ausbau der israelischen Siedlungspolitik in den besetzten Gebieten seit 1993, dem Zeitpunkt des Oslo-Abkommens, die willkürliche Zerstörung von Häusern, Gärten, Olivenhainen, Infrastruktur, die täglichen Demütigungen der Palästinenser und schließlich die de facto-Annektion von etwa 10 Prozent des Westjordanlandes mittels einer ‚Zaun’ genannten, in Teilen acht Meter hohen Mauer hatten die gleiche fatale Wirkung“ – bereits die Tatsache, dass das angebliche „israelische Unrecht“ weit mehr Raum beansprucht als der zur „Zerstörung des Geistes von Oslo“ verniedlichte Judenmord, unterstreicht, dass es nicht um einen gleich großen Abstand zu beiden Seiten geht – was schon fatal genug wäre –, sondern um eine unzweideutige Schuldzuweisung an Israel. Der Lösungsvorschlag kommt daher einer Drohung gleich: „Deutsche Politik könnte hier, wenn sie sich als freundschaftlich nach beiden Seiten versteht, einen Beitrag leisten.“
 Und so geht der Sermon schier endlos weiter: Antisemitismus sei zwar weiterhin auch „im Mainstream der deutschen Bevölkerung“ zu finden – zu dem sich die Autoren offenbar nicht zählen, obwohl sie sich in ihm bewegen wie Maos Fisch im Wasser –, doch genauso verurteilungswürdig sei der „problematische Philosemitismus“, weil „die bloße Umkehrung eines starren, gegen die Realität abgeschotteten Feindbildes letztlich nur dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen ergibt und ebenfalls gegen die Realität und jedes differenzierte Urteil immunisiert“. Die Politikwissenschaftler schrecken in diesem Zusammenhang nicht einmal davor zurück, Adornos Ausführungen zur Ticketmentalität für sich zu reklamieren, um schließlich den Schluss zu ziehen: „Zusammen mit dem eingangs erwähnten unausgesprochenen Verbot offener Kritik an israelischen Entscheidungen stärkt der Philosemitismus in Deutschland den Antisemitismus eher als dass er ihn schwächt.“ Was diese Schreibkünstler unter „Philosemitismus“ verstehen – nämlich die allemal gebotene Parteinahme für den jüdischen Staat –, ist in Deutschland genauso wenig nachzuweisen wie ein „unausgesprochenes (!) Verbot offener Kritik an israelischen Entscheidungen“, weshalb zwangsläufig jeder Beleg für seine Existenz unterbleibt. Nichtsdestotrotz soll er den Antisemitismus „eher stärken“, was nicht weniger heißt, als dass die Juden es – einmal mehr – selbst schuld sind, wenn sie um ihr Leben fürchten müssen.
Und so geht der Sermon schier endlos weiter: Antisemitismus sei zwar weiterhin auch „im Mainstream der deutschen Bevölkerung“ zu finden – zu dem sich die Autoren offenbar nicht zählen, obwohl sie sich in ihm bewegen wie Maos Fisch im Wasser –, doch genauso verurteilungswürdig sei der „problematische Philosemitismus“, weil „die bloße Umkehrung eines starren, gegen die Realität abgeschotteten Feindbildes letztlich nur dasselbe mit umgekehrten Vorzeichen ergibt und ebenfalls gegen die Realität und jedes differenzierte Urteil immunisiert“. Die Politikwissenschaftler schrecken in diesem Zusammenhang nicht einmal davor zurück, Adornos Ausführungen zur Ticketmentalität für sich zu reklamieren, um schließlich den Schluss zu ziehen: „Zusammen mit dem eingangs erwähnten unausgesprochenen Verbot offener Kritik an israelischen Entscheidungen stärkt der Philosemitismus in Deutschland den Antisemitismus eher als dass er ihn schwächt.“ Was diese Schreibkünstler unter „Philosemitismus“ verstehen – nämlich die allemal gebotene Parteinahme für den jüdischen Staat –, ist in Deutschland genauso wenig nachzuweisen wie ein „unausgesprochenes (!) Verbot offener Kritik an israelischen Entscheidungen“, weshalb zwangsläufig jeder Beleg für seine Existenz unterbleibt. Nichtsdestotrotz soll er den Antisemitismus „eher stärken“, was nicht weniger heißt, als dass die Juden es – einmal mehr – selbst schuld sind, wenn sie um ihr Leben fürchten müssen.Wer oder was hilft also in der Not? Dies: „sich vorzustellen, wie in der gegenwärtigen Situation wohl die vielen Intellektuellen, Schriftsteller, Künstler und Musiker jüdischer Herkunft von Adorno über Einstein, Freud und Marx bis zu Zweig reagiert hätten“ – tote Juden also, mit denen man im Unterschied zu den lebenden nicht nur kein Problem hat, weil sie sich nicht mehr wehren können, sondern „auf die wir so stolz sind und ohne die die deutsche Kultur und der deutsche Beitrag zur Wissenschaft um so vieles ärmer wären“. Der Publizist Eike Geisel hatte schon zu Beginn der 1990er Jahre in seinem Buch „Die Banalität der Guten“ das Nötige zu dieser deutschen Klage über den Verlust durch die Austreibung und Ermordung der Juden gesagt: „[Sie] ist nicht ernst gemeint. Es handelt sich dabei um eine weinerliche Selbstbezogenheit, nicht um Trauer über andere, sondern um Mitleid mit der eigenen Banalität, kurz: um die Behauptung, die Deutschen hätten sich mit ihren Verbrechen selbst etwas angetan. [...] [Sie versichern] sich in einer Art posthumer Familienzusammenführung, dass sie selbst den Verlust eines berühmten Onkels oder einer wohlhabenden Tante zu beklagen hätten.“ Nicht nur deshalb würden sich die Genannten von Adorno bis Zweig mit Grausen wenden, könnten sie diese Zeilen ihrer selbst ernannten Erbverwalter noch vernehmen: „Wir sind überzeugt, dass sie den folgenden Satz unterschreiben würden: Nur Gleichheit und Respekt vor Recht und Völkerrecht können ein friedliches Zusammenleben gewährleisten und sind die einzigen Garanten für eine dauerhafte Existenz des Staates Israel und des zukünftigen Staates Palästina in Sicherheit – und für die Sicherheit von Juden und Jüdinnen bei uns und in aller Welt.“
Nichts zeigt die ganze Erbärmlichkeit geisteswissenschaftlichen Schaffens in Deutschland deutlicher als dieses Manifest, das in eine nicht ganz unwichtige sozialdemokratische Tageszeitung gehievt wurde und – so steht zu befürchten – konstruktive Diskussionen anstoßen soll. Seinen Kulminationspunkt erreicht es im Schlusssatz: „Das Eintreten für die Menschenrechte, wo und durch wen immer sie verletzt werden, sind wir den Opfern des Nationalsozialismus schuldig.“ Es ist der alte Wein in inzwischen auch nicht mehr ganz so neuen Schläuchen, der hier verköstigt wird; es ist ein modernisierter Antisemitismus, der via Antizionismus bei der „legitimen Israel-Kritik“ und den „Menschenrechten“ gelandet ist – nicht trotz, sondern gerade wegen Auschwitz – und der doch seine Herkunft nicht verleugnen kann; es ist der „Muff von tausend Jahren“, dessen Odeur längst auch von Akademikern verströmt wird, die dereinst angetreten waren, es mitsamt der Talare zu entsorgen, und die doch nur nicht minder streng Riechendes zu produzieren imstande sind. Studentischer Protest wird sich dagegen allerdings kaum regen. Studiengebühren sind schließlich schlimmer.
Hattips: barbarashm, Clemens Heni