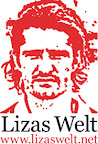Reggae & Regression
 Wenn die Welt nolens volens zum globalen Dorf wird, brauchen die verschiedenen Nester ihre jeweilige Begleitmusik dazu. Über die Verspießerung der Punkszene ist in diesem Zusammenhang an anderer Stelle schon das Nötige gesagt worden, aber die No Globals und ihre Sympathisanten haben noch mehr aus dem Repertoire des kulturrelativistischen Multi-Kulti-Romantizismus zu bieten: nicht zuletzt den Reggae nämlich, der „seit den 60ern einen stetigen Popularitätszuwachs hat verzeichnen können“ und dennoch bis heute „trotz Bob Marley eher ein Nischendasein in der Popkultur“ fristet, wie Mathias Schütz in der Vierteljahreszeitschrift Prodomo befand, um gleichwohl zu ergänzen: „Im Zuge des Durchbruchs von Black Music in den 90ern haben es auch einige Reggaeacts zu internationalem Ruhm geschafft“ – einem teilweise reichlich zweifelhaften allerdings: „Denn Reggae ist nicht beschränkt auf die gängigen, von den Künstlern, Promotern und Medien so willig wie reflexartig reproduzierten Klischees über Sonne, Liebe und Kiffen. Vielmehr lassen sich in ihm zwei verwobene inhaltliche rote Fäden erkennen, die der genaueren Betrachtung bedürfen, nämlich eine verschwörungstheoretische Grundtendenz und eine aggressiv vorgetragene Homophobie.“ Daraus resultiere in der entsprechenden Szene ein regelrechter „Kulturkampf gegen Zionisten und Schwule“.
Wenn die Welt nolens volens zum globalen Dorf wird, brauchen die verschiedenen Nester ihre jeweilige Begleitmusik dazu. Über die Verspießerung der Punkszene ist in diesem Zusammenhang an anderer Stelle schon das Nötige gesagt worden, aber die No Globals und ihre Sympathisanten haben noch mehr aus dem Repertoire des kulturrelativistischen Multi-Kulti-Romantizismus zu bieten: nicht zuletzt den Reggae nämlich, der „seit den 60ern einen stetigen Popularitätszuwachs hat verzeichnen können“ und dennoch bis heute „trotz Bob Marley eher ein Nischendasein in der Popkultur“ fristet, wie Mathias Schütz in der Vierteljahreszeitschrift Prodomo befand, um gleichwohl zu ergänzen: „Im Zuge des Durchbruchs von Black Music in den 90ern haben es auch einige Reggaeacts zu internationalem Ruhm geschafft“ – einem teilweise reichlich zweifelhaften allerdings: „Denn Reggae ist nicht beschränkt auf die gängigen, von den Künstlern, Promotern und Medien so willig wie reflexartig reproduzierten Klischees über Sonne, Liebe und Kiffen. Vielmehr lassen sich in ihm zwei verwobene inhaltliche rote Fäden erkennen, die der genaueren Betrachtung bedürfen, nämlich eine verschwörungstheoretische Grundtendenz und eine aggressiv vorgetragene Homophobie.“ Daraus resultiere in der entsprechenden Szene ein regelrechter „Kulturkampf gegen Zionisten und Schwule“.Dessen Antrieb sei der Wunsch „nach konkreter, quasi aus dem Nichts heraus entstehender Unmittelbarkeit“, und dieses Bedürfnis laufe „nicht selten auf ein äußerst krudes und paranoides Weltbild hinaus“, konstatiert Schütz in einem Gastbeitrag für Lizas Welt. Denn das Streben nach dem Unvermittelten „und die darin enthaltene Überwindung der entfremdeten Verhältnisse aus einem bloßen Akt des Bewusstseins heraus erinnern nicht ohne Grund an genau das, was heute von friedensbewegten Linken bis hin zur NPD unter dem Schlagwort der ‚Kultur’ als verteidigenswert auf die Tagesordnung gesetzt wird: an eine auf bloß überlieferten – das heißt auf in keinerlei Hinsicht vernunftgemäß begründeten – Strukturen fußende Ordnung nämlich, deren Motive fast immer religiöse und/oder völkische sind, die das Individuum in eine hierarchische und paternalistische Gemeinschaft zwingen und es somit faktisch negieren.“ Woher dieses regressive Bedürfnis kommt, wann es handgreiflich wird und welchen Anteil eine deutsche Reggae-Zeitschrift an diesem Soundtrack des Kulturrelativismus hat, wird im Folgenden verraten.
 Mathias Schütz
Mathias SchützSoundtrack des Kulturrelativismus
Der Begriff Reggae erzeugt bei fast jedem, der ihn vernimmt, unweigerlich Assoziationen, wobei neben jener Art von karibischer – genauer: jamaikanischer – Musik, die sich durch einen bestimmten, eingängigen Rhythmus auszeichnet, meist noch weitere Eindrücke auftauchen. Bob Marleys Erscheinung und seine Musik haben wohl maßgeblich dazu beigetragen, dass Reggae heute großenteils mit dem Konsum von Marihuana, langen Dreadlocks und einem zunächst unbestimmten Begriff von Harmonie, einer als universell propagierten „one love“, in Verbindung gebracht wird. So weit, so unproblematisch. Erst bei näherer Betrachtung erweist sich gerade das verlockende Bild des ungezwungenen und harmonischen Miteinanders als ausgesprochen trügerisch. Denn wenn Liebe – jene privateste und intimste aller menschlichen Empfindungen – zu einem öffentlichen, gar universellen Prinzip erhoben wird, ist stets bestenfalls mit einem massiven Realitätsverlust zu rechnen, wie etwa die hauptberufliche Wiederkäuerin von Selbst(v)erbrochenem, Nena, demonstrierte, als sie angesichts der Riots in den französischen Banlieus in einer TV-Talkrunde meinte, die ganzen Politiker mit ihren tollen Plänen könnten ihr gestohlen bleiben; was es brauche, sei doch nichts als die Liebe. Meist belässt es das Bedürfnis nach weltweiter Eintracht aber nicht bei solchen Infantilitäten. Der vorgetragene Wunsch nach konkreter, quasi aus dem Nichts heraus entstehender Unmittelbarkeit läuft vielmehr nicht selten auf ein äußerst krudes und paranoides Weltbild hinaus: Die Menschen seien bloß mit ihren profanen, meist materiellen Interessen beschäftigt und kümmerten sich nicht um ihre Umwelt (in Reggaetexten oft beispielhaft dargestellt durch das Bild des Nachbarn, dessen Namen man nicht einmal kenne). Diese babylonische Lebensweise führe unweigerlich zu Neid, Feindschaft und Krieg. Deswegen bedürfe es einer kollektiven Rückbesinnung auf die Bedeutung des Lebens, die sich darstelle in Enthaltsamkeit, Spiritualität und der Liebe zu allen Lebewesen.
Wer hier mit einiger Berechtigung anmerkt, eine solch asketische Utopie sei nicht eines jeden Menschen Sache – da der Sinn des Lebens zuallererst der Deutungshoheit des Individuums unterworfen sei und es nun wirklich keinen Grund und erst recht keine Möglichkeit gebe, etwas wie die Liebe auf eine ganze Menge an Menschen zu projizieren, die wohl selbst noch in der besten aller Welten aufgrund diverser Persönlichkeitsmerkmale ganz einfach unausstehlich seien –, der hat sich damit in den Augen der Apologeten unweigerlich und unbewusst als lebendiger Zombie geoutet. Der Wunsch nach einer plötzlichen Unmittelbarkeit und die darin enthaltene Überwindung der entfremdeten Verhältnisse aus einem bloßen Akt des Bewusstseins heraus erinnern dabei nicht ohne Grund an genau das, was heute von friedensbewegten Linken bis hin zur NPD unter dem Schlagwort der Kultur als verteidigenswert auf die Tagesordnung gesetzt wird: an eine auf bloß überlieferten – das heißt auf in keinerlei Hinsicht vernunftgemäß begründeten – Strukturen fußende Ordnung nämlich, deren Motive fast immer religiöse und/oder völkische sind, die das Individuum in eine hierarchische und paternalistische Gemeinschaft zwingen und es somit faktisch negieren. Dass in Reggaetexten besonderen Wert auf die „roots“ gelegt und Reggae selbst als „roots and culture music“ firmiert, bestätigt den Eindruck, dass hier von einer grundlegenden Substanz ausgegangen wird, aus der sich die Gestaltung des menschlichen Daseins ausnahmslos ableiten lässt. Das Fundament dieser Substanz bildet Gott, dem der einzelne unterworfen ist und dessen Urteil alleine über Gut und Böse entscheidet, wodurch weltliches Recht vollkommen hinfällig wird; zudem werden die Wurzeln für die meist schwarzen Musiker in Afrika verortet und nachgerade mystifiziert: „No matter where you come from, as long as you’re a black man, you are an African“, sang in den 1970er Jahren Peter Tosh und stellte so besonders prägnant auf die ewige, allein auf der Hautfarbe beruhende Verwurzelung der Schwarzen ab, aus der sich der Wunsch nach einer Repatriierung nach Afrika, dem „Zion“ des Reggae, ableitet. Hier wird die oktroyierte Identitätsstiftung überdeutlich – und wer sich ihr verweigert, gilt zumindest als Ausgestoßener, wenn nicht gleich als vogelfrei.
Nicht anders verhält es sich mit jenen Ideen, die unter dem Begriff der „one love“ von Reggaeprotagonisten ganz selbstverständlich vertreten werden. Die Liebe als Allgemeines ist nicht ohne Selbstbeschränkung, die propagierte „unity“ nicht ohne Unterwerfung des einzelnen unter die Prämissen der Gemeinschaft sowie durch den Ausschluss all derer zu haben, die nicht in dem beschränkten sakralen Weltbild aufgehen. So werden in Reggaetexten immer wieder diejenigen angeprangert, die angeblich nur dem eigenen, partikularen Glück hinterherlaufen, darunter nicht zuletzt „die Politiker“, die – wie es für eine immer mehr dem brutalen Bandenwesen unterworfene Elendsökonomie à la Jamaika typisch ist – durch und durch korrupt seien. Hieraus ergibt sich dann die Folgerung, dass Jamaika und die Welt neuer, echter „Leaders“ bedürften, die nicht korrupt, sondern „righteous“ und „conscious“ zu sein hätten, also über eine direkte Verbindung zum scheinbar einheitlichen Willen des Volkes verfügen sollten. Was in diesem Wunsch nach weltlicher Erlösung kulminiert, ist das Bedürfnis nach Unmittelbarkeit, das heißt nach Einheit und Eintracht in einer Gemeinschaft, die nach festen, von oben determinierten und unhinterfragbaren Prinzipien organisiert ist. Gesellschaftliche Nöte und Widersprüche werden nicht analysiert, sondern einfach und autoritär unter den Teppich gekehrt. Dass solch eine Methode keines der gesellschaftlichen Probleme löst, sondern allenfalls die Leidenden kurzfristig dazu veranlasst, ihr Leid als ein notwendiges aufzufassen, ist ebenso programmiert wie die zwangsläufig darauf folgende Frustration und die Wut über das nicht enden wollende Elend sowie der Wunsch, diesem Namen und Anschrift zu geben.
 Dafür bieten sich vor allem das politische Führungspersonal und die Polizei an, die gleichsam Symbole des empfundenen Unrechts und daher stets auch Zielscheiben wütender Reggaetexte sind. Doch wie schon der deutsche Prolet bei allem Gezeter gegen „die da oben“ bald resignierend feststellt, dass „die“ ja „irgendwie auch nur ihren Job machen“ und zudem Teil der Schicksalsgemeinschaft seien, so wird der ganze Hass im jamaikanischen Reggae aus einer in der Bevölkerung tief verwurzelten religiösen Grundmotivation heraus auf die eine Gruppe von Menschen projiziert, die ganz einfach nicht dazugehören sollen: Homosexuelle, abfällig bezeichnet als „batty boys“ oder „chi chi men“. Dabei wird Homosexualität nicht einfach „nur“ – was schon übel genug wäre – als etwas Abzulehnendes behandelt, sondern als Feind schlechthin. Entsprechend drastisch fallen die Texte aus: Schwule und Lesben werden wahlweise erschossen, erhängt oder verbrannt; fest steht jedenfalls: „Dem haffi dead“ (Sie müssen sterben). Das hat Konsequenzen: Während die Hasstiraden und lyrischen Verbrennungen von korrupter Politik, Papsttum und Polizei respektive von deren Kollektividiom „Babylon“ symbolisch bleiben müssen – denn die jeweiligen Institutionen sind nicht als solche greifbar, und ihren Angehörigen wird prinzipiell die Fähigkeit zur Rückbesinnung zugesprochen –, kann die pathologisierte Homosexualität in Person der Homosexuellen auch ganz konkret zum Angriffsziel werden und sich in Akten homophober Gewalt manifestieren. Die generell sehr gewalttätigen Reggaetexte finden ihren Höhepunkt dementsprechend stets bei diesem Thema, und selbst die Anhänger der Rastafari-Sekte – die am lautstärksten Frieden und Einigkeit propagieren und ihre positive Grundhaltung durch die niedliche Marotte zum Ausdruck bringen, jegliche negativ zu verstehende Silbe aus ihrem Wortschatz zu streichen („overstand“ statt „understand“, „yesvember“ statt „november“ etc.) – werden dann zu gnadenlosen Furien. Über alles lässt man mit sich reden, über Religion, Geschichte und Politik, nur die Homosexualität ist nicht verhandelbar. Sie ist das Gegenbild, das jeder Gemeinschaft notwendig immanent ist, die pathische Projektion, der Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung nicht ohne Grund eine homophobe Grundmotivation zusprachen, also eine einseitige Spiegelung, die dem stigmatisierten Gegenüber alles Böse und Gewalttätige zuspricht, um ihm dann selbst Gewalt antun zu können.
Dafür bieten sich vor allem das politische Führungspersonal und die Polizei an, die gleichsam Symbole des empfundenen Unrechts und daher stets auch Zielscheiben wütender Reggaetexte sind. Doch wie schon der deutsche Prolet bei allem Gezeter gegen „die da oben“ bald resignierend feststellt, dass „die“ ja „irgendwie auch nur ihren Job machen“ und zudem Teil der Schicksalsgemeinschaft seien, so wird der ganze Hass im jamaikanischen Reggae aus einer in der Bevölkerung tief verwurzelten religiösen Grundmotivation heraus auf die eine Gruppe von Menschen projiziert, die ganz einfach nicht dazugehören sollen: Homosexuelle, abfällig bezeichnet als „batty boys“ oder „chi chi men“. Dabei wird Homosexualität nicht einfach „nur“ – was schon übel genug wäre – als etwas Abzulehnendes behandelt, sondern als Feind schlechthin. Entsprechend drastisch fallen die Texte aus: Schwule und Lesben werden wahlweise erschossen, erhängt oder verbrannt; fest steht jedenfalls: „Dem haffi dead“ (Sie müssen sterben). Das hat Konsequenzen: Während die Hasstiraden und lyrischen Verbrennungen von korrupter Politik, Papsttum und Polizei respektive von deren Kollektividiom „Babylon“ symbolisch bleiben müssen – denn die jeweiligen Institutionen sind nicht als solche greifbar, und ihren Angehörigen wird prinzipiell die Fähigkeit zur Rückbesinnung zugesprochen –, kann die pathologisierte Homosexualität in Person der Homosexuellen auch ganz konkret zum Angriffsziel werden und sich in Akten homophober Gewalt manifestieren. Die generell sehr gewalttätigen Reggaetexte finden ihren Höhepunkt dementsprechend stets bei diesem Thema, und selbst die Anhänger der Rastafari-Sekte – die am lautstärksten Frieden und Einigkeit propagieren und ihre positive Grundhaltung durch die niedliche Marotte zum Ausdruck bringen, jegliche negativ zu verstehende Silbe aus ihrem Wortschatz zu streichen („overstand“ statt „understand“, „yesvember“ statt „november“ etc.) – werden dann zu gnadenlosen Furien. Über alles lässt man mit sich reden, über Religion, Geschichte und Politik, nur die Homosexualität ist nicht verhandelbar. Sie ist das Gegenbild, das jeder Gemeinschaft notwendig immanent ist, die pathische Projektion, der Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung nicht ohne Grund eine homophobe Grundmotivation zusprachen, also eine einseitige Spiegelung, die dem stigmatisierten Gegenüber alles Böse und Gewalttätige zuspricht, um ihm dann selbst Gewalt antun zu können.Dazu passt auch der im Reggae weit verbreitete Begriff des „Parasiten“, mit dem in erster Linie Homosexuelle attackiert werden. Die Reggae-Boyband T.O.K. beispielsweise hat in einem Interview mit der deutschen Reggae-Zeitschrift Riddim diese Identifikation von Schwulen und Lesben mit schmarotzendem Ungeziefer sehr anschaulich demonstriert, als sie auf die Bedeutung des Wortes „chi chi“ angesprochen wurde, der ihrem mittlerweile zum Klassiker avancierten Szenehit, der homophoben Hymne Chi chi man, zugrunde liegt: „Chi Chi bedeutet in Jamaika wirklich Termite. Ein Tier, dass alles auffrisst, vor allem Holz, und so Häuser zum Einsturz bringt. Gleichzeitig ist der Begriff auch ein Synonym für einen Parasiten, einen korrupten Feind der Gesellschaft, der durch seine Gefräßigkeit das Gemeinwesen aushöhlt und zerstört.“ (Nr. 2/2002, S. 41) Das sind Worte, die eindeutige Assoziationen erwecken sollten. Aber die Riddim handelt ihrem Selbstbild gemäß als unverfälschendes Sprachrohr einer authentischen Kultur und verweigert sich strikt jeglicher kritischen Kommentierung – sofern sie nicht gerade die Begrifflichkeiten ihrer Schützlinge übernimmt, etwa wenn sie Festivalsponsoren, die ihre Unterstützung an ein Verbot von homophoben Hatelyrics knüpfen, offen als „Parasiten“ (Nr.28/2006, S. 14) beschimpft. Zwar wurde das Thema Homophobie und Reggae ausführlich in dieser Zeitschrift behandelt, allerdings vollkommen unkritisch, ja regelrecht apologetisch. So postulierte der Riddim-Kolumnist und ideologische Stichwortgeber des deutschen Reggae-Selbstverständnisses, Ulli Güldner, „dass sich Reggae [...] und militante Homophobie unmöglich auseinanderdividieren lassen“ (Nr. 5/2002, S. 44) – wodurch er impliziert, zumindest jamaikanischer Reggae sei ohne homophobe Elemente gar kein Reggae im eigentlichen Sinn.
 Die Homophobie erscheint so nicht nur als tatsächlich vorwiegende Wahnform jamaikanischer Gesellschaft und Musik, sondern als etwas Substanzielles, ohne das Reggae nicht gedacht werden kann. Demzufolge sei auch der internationale Protest von Homosexuellenverbänden im Rahmen der Kampagne Stop Murder Music – der in den letzten Jahren zur Absage so mancher Reggae-Tournee führte – strikt abzulehnen, befindet die Riddim. Denn die Verbände verstünden gar nicht, aus welchen Gründen es jamaikanische Homophobie gibt – als wäre das ein Grund, Hatelyrics hinzunehmen –; der Protest sei somit eine illegitime Einmischung in fremde Angelegenheiten. Die Zeitschrift verharmlost darüber hinaus die Auseinandersetzungen um die Homophobie in Reggaetexten systematisch als „Kampf der Sexualitäten“ (Nr. 5/2002, S. 36), so, als hätten die Verbände auch ein Problem mit Heterosexualität und als werde daher zur Verdeutlichung dieses Standpunkts in gleichem Maße zu Hasstiraden und Mordaufrufen gegriffen. Das Arsenal des Kulturrelativismus wird hier in seiner ganzen Einfalt dargeboten.
Die Homophobie erscheint so nicht nur als tatsächlich vorwiegende Wahnform jamaikanischer Gesellschaft und Musik, sondern als etwas Substanzielles, ohne das Reggae nicht gedacht werden kann. Demzufolge sei auch der internationale Protest von Homosexuellenverbänden im Rahmen der Kampagne Stop Murder Music – der in den letzten Jahren zur Absage so mancher Reggae-Tournee führte – strikt abzulehnen, befindet die Riddim. Denn die Verbände verstünden gar nicht, aus welchen Gründen es jamaikanische Homophobie gibt – als wäre das ein Grund, Hatelyrics hinzunehmen –; der Protest sei somit eine illegitime Einmischung in fremde Angelegenheiten. Die Zeitschrift verharmlost darüber hinaus die Auseinandersetzungen um die Homophobie in Reggaetexten systematisch als „Kampf der Sexualitäten“ (Nr. 5/2002, S. 36), so, als hätten die Verbände auch ein Problem mit Heterosexualität und als werde daher zur Verdeutlichung dieses Standpunkts in gleichem Maße zu Hasstiraden und Mordaufrufen gegriffen. Das Arsenal des Kulturrelativismus wird hier in seiner ganzen Einfalt dargeboten.Die Konsequenzen, die man bei der Riddim zu ziehen bereit ist, beschränken sich dementsprechend auf den so genannten Dialog, wie beispielsweise im Juni 2006 bei einem Schweizer Reggaefestival: Der Homosexuellenverband Pink Cross hatte sich bereit erklärt, auf eine Mobilisierung gegen den homophoben Headliner Buju Banton zu verzichten und stattdessen einen Informationsstand auf dem Festivalgelände aufzubauen. Die dortigen Reaktionen waren jedoch eindeutig: „Noch vor 23 Uhr wurde die Aktion überstürzt abgebrochen – die PC-Aktivisten verließen den Ort via Hinterausgang: ‚Es war genug! Die Stimmung wurde merklich aggressiver, es lag etwas in der Luft.’“ (Nr. 27/2006, S. 12) Die angesichts solcher Ereignisse sich aufdrängende Frage, auf welcher gemeinsamen Basis denn ein Dialog zwischen Homosexuellen und einer dogmatisch-homophoben Kultur, die selbst eine friedliche Koexistenz a priori ausschließt, sich vollziehen soll, bleibt von Seiten der Riddim unbeantwortet, da sie angesichts der offensichtlichen Unfähigkeit der Redakteure und Mitarbeiter, ein professionelles Mindestmaß an Distanz zum umschwärmten Objekt der Begiere einzuhalten, erst gar nicht gestellt wird. Stattdessen hält man unbeirrt an seinem konzeptionslosen Konzept fest: „Dialog statt Konflikt, gemeinsame Aufklärung statt harte Fronten.“ (ebd.) Fragwürdig bleibt dabei allerdings, wie diese „gemeinsame Aufklärung“ letztlich aussehen soll, denn die einseitige Dialogbereitschaft durch Pink Cross hat bloß die geschilderten Aggressionen hervorgerufen, die einzig von Aufklärungsresistenz und Gewaltbereitschaft auf Seiten vieler Reggaeanhänger zeugen. Der gemeinsame Dialog ist eine Fiktion, denn er war und bleibt zum einen einseitig und zum anderen ein Monolog; darüber hinaus fährt er erwartungsgemäß gegen die homophobe Wand. Ohne allzu unpassende Analogien ziehen zu wollen, sollte man sich angesichts der dargestellten Realitätsverleugnung getrost an die klugen Worte erinnern, mit denen einst Wiglaf Droste das gutmenschliche Bedürfnis „Mit Nazis reden“ kommentierte: „Warum? Haben sie einem etwas zu sagen? Ist nicht hinlänglich bekannt, was sie denken, fordern und propagieren? Muss man an jeder Mülltonne schnuppern?“
 Während also von Seiten der Riddim und der Reggae-Fangemeinde unendlicher und voraussetzungsloser Respekt für die Absurditäten der Reggaekultur verlangt wird, ist man selbst nicht zimperlich gegenüber jenen, die als Feinde der Kultur eindeutig ausgemacht sind. Und das beschränkt sich nicht auf Sponsoren, denen das Image und der monetäre Erfolg wichtiger sind als eine eigenwillige Reggae-Identität, oder auf die Homosexuellenverbände, die gegen das öffentliche Propagieren der Homophobie mobilisieren. Heftige Anfeindungen muss sich beispielsweise auch Matisyahu (Foto) gefallen lassen, ein amerikanischer, chassidisch-orthodoxer Jude, der mit seinem Konzept von Reggae sehr erfolgreich ist; sein Album Youth stand hoch in den US-amerikanischen Charts. Anstatt jedoch – jenseits des geschmacklich prinzipiell nicht zu Diskutierenden – einzugestehen, dass Matisyahu der musikalischen und textlichen Reggaemonotonie, die nicht zuletzt Kind der hyperinflationären Musikproduktion auf Jamaika ist, einige Elemente und Erfahrungen hinzuzufügen weiß, wird der Parvenü lieber auf seine Kulturtauglichkeit überprüft und vom schon erwähnten deutschen Reggae-Großinquisitor Ulli Güldner in der Riddim als nicht würdig befunden: „Album Numero Drei eines Thora schwingenden hassidischen Troubadours, dem neuesten Abräumer in ‚Middle America’s’ vannilleweißen Trabantenstädten, und – so sicher wie das ‚Shalom’ in der Synagoge! – auch dem nächsten Multiplatin-‚Mu’fucker’ mit Pole-Position-Abo bei Amazon, Wal-Mart, Best Buy und iTunes. Don Mega in einer Welt mit anderen Worten, in denen Reggae-Artists, die tatsächlich relevant sind, in etwa so häufig auftauchen wie schwarze Gesichter in Woody Allen-Filmen.“ (Nr. 25/2006, S. 74)
Während also von Seiten der Riddim und der Reggae-Fangemeinde unendlicher und voraussetzungsloser Respekt für die Absurditäten der Reggaekultur verlangt wird, ist man selbst nicht zimperlich gegenüber jenen, die als Feinde der Kultur eindeutig ausgemacht sind. Und das beschränkt sich nicht auf Sponsoren, denen das Image und der monetäre Erfolg wichtiger sind als eine eigenwillige Reggae-Identität, oder auf die Homosexuellenverbände, die gegen das öffentliche Propagieren der Homophobie mobilisieren. Heftige Anfeindungen muss sich beispielsweise auch Matisyahu (Foto) gefallen lassen, ein amerikanischer, chassidisch-orthodoxer Jude, der mit seinem Konzept von Reggae sehr erfolgreich ist; sein Album Youth stand hoch in den US-amerikanischen Charts. Anstatt jedoch – jenseits des geschmacklich prinzipiell nicht zu Diskutierenden – einzugestehen, dass Matisyahu der musikalischen und textlichen Reggaemonotonie, die nicht zuletzt Kind der hyperinflationären Musikproduktion auf Jamaika ist, einige Elemente und Erfahrungen hinzuzufügen weiß, wird der Parvenü lieber auf seine Kulturtauglichkeit überprüft und vom schon erwähnten deutschen Reggae-Großinquisitor Ulli Güldner in der Riddim als nicht würdig befunden: „Album Numero Drei eines Thora schwingenden hassidischen Troubadours, dem neuesten Abräumer in ‚Middle America’s’ vannilleweißen Trabantenstädten, und – so sicher wie das ‚Shalom’ in der Synagoge! – auch dem nächsten Multiplatin-‚Mu’fucker’ mit Pole-Position-Abo bei Amazon, Wal-Mart, Best Buy und iTunes. Don Mega in einer Welt mit anderen Worten, in denen Reggae-Artists, die tatsächlich relevant sind, in etwa so häufig auftauchen wie schwarze Gesichter in Woody Allen-Filmen.“ (Nr. 25/2006, S. 74)Was sich aus diesem Geschwurbel der Eigentlichkeit herauslesen lässt, ist neben einem unverkennbaren Selbstdarstellungsbedürfnis eine nachvollziehbare Verzweiflung darüber, dass Reggae-Artists sich – abgesehen von Subkultur, Eine-Welt-Kitsch und einigen Ausnahmen – ganz einfach nicht ordentlich vermarkten lassen. Man ist sauer, dass ein vermeintlich nur Dahergelaufener wie Matisyahu sich ganz postmodern Versatzstücke des Reggae aneignet und in seiner Musik verarbeitet, und kann dies nur als einen mutwilligen Hochverrat am großen Reggae-Ganzen verstehen, dem man sich mit Leib und Seele verpflichtet hat. Matisyahus Erfolg wird nicht zuletzt auf sein exotisches Äußeres zurückgeführt – was wirklich bemerkenswert ist angesichts einer Klientel, die sich vorzugsweise in wallenden Tüchern und putzigen Fantasieuniformen präsentiert und ihre langen Dreadlocks auch gerne mal unter einem zünftigen Turban versteckt. Am Stammtisch der Riddim, in deren Internetforum nämlich, werden denn auch etwas andere Töne angeschlagen: Die Nominierung Matisyahus in der Reggae-Kategorie des Grammy wird hier einhellig so kommentiert, als hätte dieser den Preis schon verliehen bekommen. Zur Wut darüber, dass die ganzen so genannten echten Artists ganz bestimmt wieder leer ausgehen werden, mischen sich dann auch schnell einige wohlvertraute Phrasen und Parolen; so weiß etwa der User Palant zu berichten: „Matisyahu wird den grammy kriegen weils in amerika ist und er jude ist! das wird ne riesen story in amerika und für die juden...“ Des weiteren ist von „mächtigen Lobbys“ die Rede, die die Geschicke zugunsten des jüdischen Sängers manipuliert hätten. Warum das Weltjudentumsfantasma ausgerechnet den Reggae-Grammy in seine Krakenarme reißen sollte und ob im Falle Eminems stets auch die notorische White-Trash-Lobby ihre Finger im Spiel hatte, wissen die anonymen Alleswisser leider nicht zu berichten. Aber dass die zitierten Statements mit Antisemitismus bestimmt nichts zu tun haben, darüber ist man sich, bis auf die sprichwörtlichen Ausnahmen, einig. Und selbst wenn doch, dann ist das noch lange kein Grund, Urteile zu fällen, denn – so bringt ein anderer User den herrschenden Ungeist auf den Punkt – jede Ideologie habe ihre Berechtigung allein schon dadurch, dass sie existiert. Na dann, Zivilisation adieu.
Weitere Informationen zur Homophobie und Zivilisationsfeindlichkeit des Reggae-Kults gibt es bei der AG No Tears for Krauts.