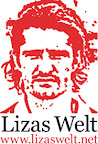Befreiungsschläge
 Partystimmung im Land des WM-Gastgebers: Sommerwetter, alle sind gut drauf, und spätestens seit Klinsmanns mittelmäßige Truppe das Wettschießen mit den fußballerisch noch limitierteren Costaricanern um die schlechtere Defensive gewonnen hat, gibt es nicht den Hauch eines Zweifels mehr, wie der kommende Weltmeister heißen wird. Die nationale Euphorie schlägt sich unübersehbar nieder in der offensiven Beflaggung zahlloser Fenster, Balkons, Autos und Kneipen sowie im Tragen entsprechender Devotionalien; es ist offensichtlich, dass in Bezug auf die Symbolik der postnazistischen deutschen Gesellschaft auch die letzten Hemmschwellen endgültig gefallen sind. Das allgegenwärtige Schwarz-Rot-Gold bedarf längst keiner Reflexion mehr: „Wenn die holländischen Fans Leipzig in Oranje hüllen, dann muss doch die Hauptstadt während der Fußball-WM ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer sein“, meint beispielsweise Frank Henkel, der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion. „Als Fans und Patrioten sind wir hier gefordert“, findet er – und es widerspricht, man ist geneigt zu sagen: selbstverständlich, niemand. Äußerstenfalls herrscht hier und da ein wenig gespielte Verwunderung, die jedoch eher Erleichterung ausdrückt:
Partystimmung im Land des WM-Gastgebers: Sommerwetter, alle sind gut drauf, und spätestens seit Klinsmanns mittelmäßige Truppe das Wettschießen mit den fußballerisch noch limitierteren Costaricanern um die schlechtere Defensive gewonnen hat, gibt es nicht den Hauch eines Zweifels mehr, wie der kommende Weltmeister heißen wird. Die nationale Euphorie schlägt sich unübersehbar nieder in der offensiven Beflaggung zahlloser Fenster, Balkons, Autos und Kneipen sowie im Tragen entsprechender Devotionalien; es ist offensichtlich, dass in Bezug auf die Symbolik der postnazistischen deutschen Gesellschaft auch die letzten Hemmschwellen endgültig gefallen sind. Das allgegenwärtige Schwarz-Rot-Gold bedarf längst keiner Reflexion mehr: „Wenn die holländischen Fans Leipzig in Oranje hüllen, dann muss doch die Hauptstadt während der Fußball-WM ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer sein“, meint beispielsweise Frank Henkel, der innenpolitische Sprecher der Berliner CDU-Fraktion. „Als Fans und Patrioten sind wir hier gefordert“, findet er – und es widerspricht, man ist geneigt zu sagen: selbstverständlich, niemand. Äußerstenfalls herrscht hier und da ein wenig gespielte Verwunderung, die jedoch eher Erleichterung ausdrückt:„Die Debatte über Patriotismus in Deutschland wird offenbar vor allem in Redaktionen geführt, auf der Straße und in den Stadien ist die verdruckste Scham im Umgang mit nationalen Symbolen offenbar einem unverkrampften Verhältnis gewichen. Selbst die Nationalhymne, in den vergangenen Jahrzehnten von vielen Länderspielbesuchern eher peinlich berührt zur Kenntnis genommen, wird heute von einem Großteil der Fans, wenn nicht gar mitgeschmettert, so doch zumindest klammheimlich mitgesummt.“Die Veränderung, die hier – stellvertretend für viele andere – der Spiegel konstatiert, wird zwar registriert, aber nirgendwo analysiert. Erstaunlich ist das nicht: Die Zurschaustellung der deutschen Farben ist eine Selbstverständlichkeit geworden. Vorbei sind die Zeiten der „verdrucksten Scham“, hinfort die Jahre der relativen Zurückhaltung, in denen autochthone Deutsche neidisch auf andere Nationen blickten, die nicht bloß bei Sportereignissen ihre jeweilige Landesfahne hissten. Vorüber ist diese quälende Selbstbeschränkung allerdings nicht erst jetzt, sondern genau genommen spätestens seit 1989/90, der so genannten Wiedervereinigung nämlich. Es folgten in regelmäßigen Abständen aufgelegte Patriotismusdebatten, bei denen sich die Protagonisten bemühten, einen ernsten, geschichtsbewussten und nachdenklichen Eindruck zu vermitteln. Dabei war der Weg bereits das Ziel, sprich: Es ging vor allem darum, Fragen nach Identität, Leitkultur, Nationalgefühl und ähnlichem Firlefanz als solche diskutabel zu machen. Auch vermeintlich kritische Stimmen stellten deren grundsätzliche Berechtigung nicht in Abrede, sondern mühten sich ganz staatstragend nach vermeintlich adäquaten Antworten.
Und so ging es bei diesen deutschen Selbstgesprächen mal um Verfassungspatriotismus, mal um die Zivilgesellschaft, mal um das Staatsbürgerschaftsrecht und mal um die Integration von Ausländern. Selten vergaß ein Redner dabei, rituell und sinnentleert auf „unsere Vergangenheit“ hinzuweisen, die bekanntlich Mahnung und Warnung sei – woraus jedoch selbstverständlich nicht zu folgen habe, gänzlich die Finger von dem ganzen Mumpitz zu lassen, sondern sich im Gegenteil mit besonderer Verve auf die Causa zu stürzen, gerne mit dem Argument, man dürfe sie schließlich nicht denen überlassen, die jedoch mit vollem Recht das Copyright der Antwort auf die Frage, was deutsch ist, für sich beanspruchen.
 Die Linke wiederum – und zwar sowohl ihr parteienförmiger Teil von der SPD über die Grünen bis zur PDS respektive Linkspartei als auch ihre außerparlamentarischen Gruppen und Bewegungen – hatte in diesem Zusammenhang selten nennenswert Besseres zu bieten als diejenigen, die sie zu bekämpfen vorgab. Schon die KPD warb für ein angeblich anderes und besseres Deutschland, das es in Form der DDR schließlich auch gab und das nicht nur abstoßenden Stahlhelmsozialismus zu bieten hatte, sondern sich auch von allem Unbill des Nationalsozialismus frei wähnte und daher umso ungenierter Antizionismus und Antiimperialismus zur Staatsdoktrin machte, gegen den „angloamerikanischen Bombenterror“ zu Felde zog, Auschwitz als Werk einer gierigen Clique von Mächtigen namens Monopolkapital verharmloste und den Antisemitismus bloß für ein Mittel zur Spaltung der werktätigen Massen hielt. Das Ende dieses vermeintlichen Vorzeigevaterlands hinterließ bei den Linken in Ost wie West zunächst eine gewisse Ratlosigkeit, bis der Regierungsantritt von Rot-Grün 1998 plötzlich eine neue Option zu eröffnen schien, ein „unverkrampftes Verhältnis“ zu „nationalen Symbolen“ zu bekommen, wie der Spiegel es ausdrückt.
Die Linke wiederum – und zwar sowohl ihr parteienförmiger Teil von der SPD über die Grünen bis zur PDS respektive Linkspartei als auch ihre außerparlamentarischen Gruppen und Bewegungen – hatte in diesem Zusammenhang selten nennenswert Besseres zu bieten als diejenigen, die sie zu bekämpfen vorgab. Schon die KPD warb für ein angeblich anderes und besseres Deutschland, das es in Form der DDR schließlich auch gab und das nicht nur abstoßenden Stahlhelmsozialismus zu bieten hatte, sondern sich auch von allem Unbill des Nationalsozialismus frei wähnte und daher umso ungenierter Antizionismus und Antiimperialismus zur Staatsdoktrin machte, gegen den „angloamerikanischen Bombenterror“ zu Felde zog, Auschwitz als Werk einer gierigen Clique von Mächtigen namens Monopolkapital verharmloste und den Antisemitismus bloß für ein Mittel zur Spaltung der werktätigen Massen hielt. Das Ende dieses vermeintlichen Vorzeigevaterlands hinterließ bei den Linken in Ost wie West zunächst eine gewisse Ratlosigkeit, bis der Regierungsantritt von Rot-Grün 1998 plötzlich eine neue Option zu eröffnen schien, ein „unverkrampftes Verhältnis“ zu „nationalen Symbolen“ zu bekommen, wie der Spiegel es ausdrückt.Unter einer Regierung Kohl wäre wohl noch Empörung zu vernehmen gewesen, hätte diese den ersten deutsche Kriegseinsatz seit 1945 damit begründet, man müsse „Konzentrationslager befreien“ und „ein zweites Auschwitz verhindern“. Rudolf Scharping und Joseph Fischer jedoch brauchten nicht mit Protesten zu rechnen, als sie diese besonders dreiste Relativierung des nationalsozialistischen Vernichtungswahns propagierten; vielmehr hatten sie durchschlagenden Erfolg mit ihrem Versuch, den deutschen Nationalismus zu renovieren und ihm sozusagen ein zeitgemäßes Antlitz zu verleihen: Die „Gerade-wir-als-Deutsche“-Deutschen sind geläutert und können, nein: müssen daher dazu übergehen, offensiv überall die Einhaltung der Menschenrechte einzufordern und notfalls gewaltsam durchzusetzen, wo sie verletzt worden sein sollen. Und wer könnte das glaubwürdiger vermitteln und durchsetzen als Linke, die doch schon ihre Väter ins Gebet genommen haben und das nun bei bestem Gewissen mit den Opfern ihrer vormaligen Erziehungsberechtigten veranstalten.
Lediglich ein paar Shoa-Überlebende protestierten gegen die infame Gleichsetzung von Auschwitz und dem Kosovo – eine vernachlässigenswerte Größe für eine Regierung, die sich bei der Vergangenheitsbewältigung nicht stören lassen will. Parallel dazu setzten sich in der Debatte um die Wehrmachtsausstellung diejenigen durch, die aus ihrer Verurteilung der Verbrechen von Hitlers Armeen die Schlussfolgerung ziehen zu dürfen meinten, die Bundeswehr stehe nicht in deren Tradition, sondern sei gewissermaßen das, was Franz-Josef Strauß in ihr schon weit früher gesehen hatte: die größte Friedensbewegung. Und zwar deren bewaffneter Arm. Der unbewaffnete brachte seine Heere knapp vier Jahre später zu Hunderttausenden auf die Straße, um den kriegsgeilen Amis und Juden zu zeigen, was ein echter deutscher Frieden ist, der sich verteidigen kann gegen Alliierten Bombenterror, gegen Bush und Sharon als neuen Hitler und gegen den amerikanischen Unilateralismus. Und gegen den Nationalismus, den man selbst überwunden respektive durch einen „gesunden Patriotismus“ ersetzt glaubt und nun stattdessen vor allem in den USA und Israel ausmacht.
 Mit der Abspeisung der überlebenden NS-Zwangsarbeiter wurde de facto der Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit gezogen, den man in den Jahrzehnten davor zunehmend lauter gefordert hatte. Kurz darauf war das Holocaust-Mahnmal in Berlin fertig, und diese Koinzidenz ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn das größte Monument der Welt – das es nicht gäbe, wenn es zuvor nicht Auschwitz, Treblinka, Majdanek und Sobibór gegeben hätte – steht für die gewollte Perpetuierung der Diskussionen um die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945: Sie ist aufgearbeitet, und genau diese Errungenschaft gereicht sozusagen zum Exportschlager und Standortvorteil. Dem Modell inhärent ist eine Auszahlung der Restschuld, deren Höhe von den Nachkommen der Täter bestimmt wird und nicht von denen, die die deutsche Tat mit schwersten Schäden überstanden haben.
Mit der Abspeisung der überlebenden NS-Zwangsarbeiter wurde de facto der Schlussstrich unter die deutsche Vergangenheit gezogen, den man in den Jahrzehnten davor zunehmend lauter gefordert hatte. Kurz darauf war das Holocaust-Mahnmal in Berlin fertig, und diese Koinzidenz ist nur ein scheinbarer Widerspruch. Denn das größte Monument der Welt – das es nicht gäbe, wenn es zuvor nicht Auschwitz, Treblinka, Majdanek und Sobibór gegeben hätte – steht für die gewollte Perpetuierung der Diskussionen um die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945: Sie ist aufgearbeitet, und genau diese Errungenschaft gereicht sozusagen zum Exportschlager und Standortvorteil. Dem Modell inhärent ist eine Auszahlung der Restschuld, deren Höhe von den Nachkommen der Täter bestimmt wird und nicht von denen, die die deutsche Tat mit schwersten Schäden überstanden haben.Das alles hätte ein Helmut Kohl zumindest mit weitaus mehr Aufwand durchsetzen müssen, und auch einer Du bist Deutschland-Kampagne wäre seinerzeit wohl mit weniger Sympathie begegnet worden als heute. Diese Werbeinitiative ist daher gerade nicht der x-te Ausfluss der immer gleichen Staatsräson, wie manche Kritiker glauben, sondern vielmehr die propagandistische Flankierung einer neuen Unbeschwertheit von Volk & Führung, hinter deren Ruf nach Frieden und Völkerverständigung den ausgemachten Feinden dieses Ziels faktisch ein Krieg erklärt wird, der sich derzeit vor allem durch Sabotageaktionen gegen die USA und Israel auszeichnet und durch Appeasement gegenüber Antisemiten und eine mehrheitsfähige Gleichsetzung Israels und der USA mit NS-Deutschland die ideologische Basis geschaffen hat. Die Gegner sind jedoch im Wesentlichen dieselben geblieben.
Man kann über Sinn und Unsinn des Fahnenschwenkens und über den Mummenschanz streiten, der während eines sportlichen Großereignisses wie der Weltmeisterschaft im Fußball aufgefahren wird. Doch auch im falschen Ganzen und einer nationalstaatlich verfassten Welt sind nachts nicht alle Katzen grau. Es ist ein Unterschied, ob die englischen Fans Flagge zeigen und „Ten German Bombers“ intonieren, oder ob die Hiesigen schwarz-rot-gold auflegen und im Stadion „Steht auf, wenn ihr Deutsche seid!“ grölen. Es ist auch ein Unterschied zwischen amerikanischen, tschechischen, polnischen oder niederländischen Fahnen und Monturen und ihren deutschen Entsprechungen. Die Normalität, die durch das Zeigen deutscher Symbolik beschworen wird, kommt mit einer Selbstverständlichkeit daher, die in ihrer demonstrativen und aufdringlichen Selbstverständlichkeit den Trotz doch nicht verbergen kann: „‚Natürlich habe ich kein Problem mit der deutschen Fahne, ich bin ja deutsch’“, zitiert der Spiegel stellvertretend eine Nadine. Man lässt mit dieser Geste keinen Zweifel daran, dass man sich seinen Platz im Weltgeschehen zurückerobert hat und dabei trotzdem der Ansicht ist, noch viel mehr Geltung verdient zu haben.
In diesem Sinne reklamieren die Deutschen für sich, künftig nicht nur den Papst, sondern auch den Fußball-Weltmeister zu stellen; gleichzeitig hat man aus Prinzip, weil eigener Erfahrung viel Zuneigung für die – vermeintlich oder tatsächlich – Kleinen und Schwachen, die Exoten und Außenseiter, denn man kennt ihr Gefühl. Das gilt so lange, wie Trinidad & Tobago nur den Schweden auf die Knochen treten oder Angola Portugal nicht zur Entfaltung kommen lässt; wenn es gegen die Deutschen geht, ist allerdings selbstmurmelnd Schluss mit lustig. Gewiss hegt man auch in anderen Ländern Sympathien für die Underdogs, solange sie nicht dem eigenen Team zu nahe treten. Doch damit verhält es sich wie mit den Fahnen oder Trikots: Es ist nicht gleichgültig, ob ein Deutschlandfan den Ecuadorianern einen Sieg über Polen wünscht oder ob ein Brite hofft, dass sich die Gastgeber gegen Costa Rica blamieren.
 Einen besonders impertinenten Beleg für die Richtigkeit dieser These lieferte übrigens der Co-Kommentator des bei RTL übertragenen Spiels des Iran gegen Mexiko, der ehemalige deutsche Nationalspieler Pierre Littbarski. Nicht genug damit, dass sein Redeanteil den des eigentlichen Reporters um Längen übertraf, weil der ehemalige Kölner Kicker nahezu ohne Unterbrechung mit nervtötenden Belanglosigkeiten glänzte; er ergriff darüber hinaus in einer selbst im deutschen Fernsehen selten erlebten Penetranz Partei für die vermeintlich Chancenlosen, also den Iran. Die politischen Implikationen einer Teilnahme der von den Mullahs gehätschelten Mannschaft an einer WM behauptete Littbarski ausblenden zu können, um jedoch spätestens angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage seiner Lieblinge den „Geist von Spiez“ und „Das Wunder von Bern“ zu beschwören, mithin also eine deutsche Mythen bedienende, explizit politische Aussage zu treffen. Solche emotionalen Eruptionen sind kein Zufall; sie verbalisieren eine schon lange nicht mehr bloß heimliche Bewunderung für einen vermeintlichen Außenseiter, dessen höchster politischer Repräsentant den Holocaust leugnet und Israel vernichten will und dessen Vize unter Polizeischutz auf die Tribüne geleitet wurde.
Einen besonders impertinenten Beleg für die Richtigkeit dieser These lieferte übrigens der Co-Kommentator des bei RTL übertragenen Spiels des Iran gegen Mexiko, der ehemalige deutsche Nationalspieler Pierre Littbarski. Nicht genug damit, dass sein Redeanteil den des eigentlichen Reporters um Längen übertraf, weil der ehemalige Kölner Kicker nahezu ohne Unterbrechung mit nervtötenden Belanglosigkeiten glänzte; er ergriff darüber hinaus in einer selbst im deutschen Fernsehen selten erlebten Penetranz Partei für die vermeintlich Chancenlosen, also den Iran. Die politischen Implikationen einer Teilnahme der von den Mullahs gehätschelten Mannschaft an einer WM behauptete Littbarski ausblenden zu können, um jedoch spätestens angesichts einer sich abzeichnenden Niederlage seiner Lieblinge den „Geist von Spiez“ und „Das Wunder von Bern“ zu beschwören, mithin also eine deutsche Mythen bedienende, explizit politische Aussage zu treffen. Solche emotionalen Eruptionen sind kein Zufall; sie verbalisieren eine schon lange nicht mehr bloß heimliche Bewunderung für einen vermeintlichen Außenseiter, dessen höchster politischer Repräsentant den Holocaust leugnet und Israel vernichten will und dessen Vize unter Polizeischutz auf die Tribüne geleitet wurde.Vielleicht hat sich der prominente RTL-Experte aber vorher auch die wissenschaftlich fundierte Unbedenklichkeitsbescheinigung abgeholt:
„Für den Bielefelder Historiker Hans-Ulrich Wehler ist das neu entdeckte Selbstbewusstsein der deutschen Fans kein Zeichen für aufkeimenden Nationalismus. Der Sport rufe vielmehr einen ‚Ersatznationalismus’ hervor, ‚weil er mit Nationalfarben und einer Nationalmannschaft operiert.’ Für Wehler ist die Wiederentdeckung der Deutschlandflagge ein ‚außerordentlich flüchtiges Phänomen’, ein gefährlicher Nationalismus werde dadurch nicht hervorgerufen. Selbst das ‚Wunder von Bern’, der deutsche WM-Sieg von 1954, sei in seiner Wirkung ‚sehr wenig gefährlich’ gewesen, so Wehler, die Begeisterung sei in erster Linie dem ‚Leistungsstolz’ entsprungen.“Dem „Leistungsstolz“ nämlich, nach Auschwitz wieder für Deutschland sein zu können. Wehlers Parallelisierung der laufenden Weltmeisterschaft mit derjenigen 52 Jahre zuvor geschieht so – scheinbar – beiläufig, wie sie gezielt ist: Ein nationales Projekt findet schließlich auch unter den Intellektuellen seine Mentoren, zumal bei solchen, die immer gerne um Persilscheine ersucht werden, wenn es welche auszustellen gilt. Man kennt keine Parteien mehr, sondern nur noch Deutschlandfans, und die ach so fröhlichen Feiern können schnell in ihr Gegenteil umschlagen, wenn man es mit den Falschen hält. Ein Spiegel-Reporter bekam bei einem Selbstversuch schon mal eine Kostprobe verabreicht, wie weit die Toleranz der künftigen Weltmeister geht. Was passieren kann, wenn das Turnier einen anderen Verlauf nimmt als den von den Deutschen vorgesehenen, mag man sich da lieber nicht vorstellen. Was geschieht, wenn das ersehnte Ziel erreicht wird, allerdings erst recht nicht.
Hattips: Doro & Clemens