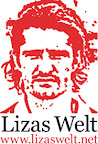Preis der Opfer
 Eins konnten die Deutschen seit jeher besonders gut: Opfer sein. Opfer des Versailler Vertrags, Opfer der Juden, die ersten Opfer Hitlers, Opfer des alliierten Bombenterrors, Opfer der Vertreibung, Opfer der Globalisierung und ganz allgemein: Opfer der Verhältnisse, der Umstände, der Geschichte. Und selbst als sie 1989 den Zweiten Weltkrieg nachträglich doch noch gewonnen hatten, mochten sie von dieser lieb gewonnenen Selbststilisierung nicht lassen, weshalb im Ostteil des Landes – das sich dereinst zum anderen und besseren Deutschland erklärt und doch nur den traditionellen Tugenden eine stahlhelmsozialistische Tünche verpasst hatte – ein weiterer Typus der Opferdeutschen gedieh: Kaum war die Mauer weg, wähnten sich die Beigetretenen als Deutsche zweiter Klasse, die sich das mit den blühenden Landschaften und ihren Brüdern und Schwestern im goldenen Westen doch ein bisschen anders vorgestellt hatten. Zur Strafe hassten sie die Wessis, zündeten Ausländer an und erfanden die Ostalgie.
Eins konnten die Deutschen seit jeher besonders gut: Opfer sein. Opfer des Versailler Vertrags, Opfer der Juden, die ersten Opfer Hitlers, Opfer des alliierten Bombenterrors, Opfer der Vertreibung, Opfer der Globalisierung und ganz allgemein: Opfer der Verhältnisse, der Umstände, der Geschichte. Und selbst als sie 1989 den Zweiten Weltkrieg nachträglich doch noch gewonnen hatten, mochten sie von dieser lieb gewonnenen Selbststilisierung nicht lassen, weshalb im Ostteil des Landes – das sich dereinst zum anderen und besseren Deutschland erklärt und doch nur den traditionellen Tugenden eine stahlhelmsozialistische Tünche verpasst hatte – ein weiterer Typus der Opferdeutschen gedieh: Kaum war die Mauer weg, wähnten sich die Beigetretenen als Deutsche zweiter Klasse, die sich das mit den blühenden Landschaften und ihren Brüdern und Schwestern im goldenen Westen doch ein bisschen anders vorgestellt hatten. Zur Strafe hassten sie die Wessis, zündeten Ausländer an und erfanden die Ostalgie.Das wiederum war die Chance für jene, die kurz zuvor noch für die Staatssicherheit verantwortlich zeichneten und denen nun sowohl der Staat als auch die Sicherheit abhanden gekommen waren: Hatten es in der heimeligen DDR nicht doch alle irgendwie besser als in der kalten und arroganten BRD? Und war das mit der Spitzelei denn wirklich so arg, dass man sich gleich dem Imperialismus an den Hals werfen musste, dessen Bourgeoisie bestenfalls Bananen und Begrüßungsgeld zu bieten bereit war? Zwar hatte niemand die Absicht, eine Seilschaft zu errichten, doch angesichts „politischer Säuberungen in den neuen Bundesländern“ konnten diejenigen, denen genau das zuvor stets eine Herzensangelegenheit gewesen war, gar nicht anders, als die Opfergemeinschaft Ostdeutschland zu beschwören und sich für deren „Recht und Würde“ zu organisieren.
Also gründete sich schon 1991 die Gesellschaft für Bürgerrechte und Menschenwürde (GBM), ließ ihren Laden auch gleich ins Vereinsregister eintragen – Ordnung muss schließlich sein – und zog fortan zuvörderst gegen „einigungsbedingte Menschenrechtsverletzungen“ und die „Diskriminierung ostdeutscher Wissenschaft, Bildung und Kultur“ zu Felde. Auf Demonstrationen forderte sie „Gleiche Rechte für Ostdeutsche“ und nannte das Prozedere seit 1989 „Kolonialisierung“ oder gleich „Apartheidpolitik“. Inzwischen gibt es sogar einen Arbeitskreis mit dem schönen Namen Insiderkomitee zur Förderung der kritischen Aneignung der Geschichte des MfS, dessen Mitglieder „ehemalige Mitarbeiter des MfS der DDR und an der wahrheitsgemäßen Aufarbeitung der Geschichte interessiert“ sind. Schließlich geht es nicht an, dass jemand behauptet, die Stasi habe so einen Bart: „Rasieren war Vorschrift.“ Oder dass Verhöre exorbitant lange gedauert hätten: „In der DDR hatten wir den Achtstundentag – der galt auch im MfS.“ Oder dass „unsere Paspelierung an Kragen und Schulterstücken“ weiß gewesen sei statt bordeauxrot. Nur ob es wirklich nötig war, selbst der Vorzeigeeisläuferin Katharina Witt noch beim Vögeln zuzugucken, erfährt man nicht. Aber das würde auch nicht recht zur Opferrolle passen.
Doch die GBM hat bei ihrem unermüdlichen Einsatz für „Bürgerrechte und Menschenwürde“ noch mehr zu bieten als Klagen über die angeblichen Benachteiligungen von Ossis: Sie führt „Rentensprechstunden“ und Kunstausstellungen durch, feiert den Jahrestag der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik – und vergibt alljährlich einen, jawohl: „Menschenrechtspreis“, der allenthalben „hohe Achtung“ genießt: „Fidel Castro vergisst nicht, ihn bei seinen Neujahrswünschen zu erwähnen.“ Zum Dank erhielt der Oberkubaner die Auszeichnung vor acht Jahren gleich selbst und wurde bei dieser Gelegenheit mit einem herzzerreißenden Gedicht belohnt, das der „namhafte Künstler und Schriftsteller“ Heinz Kamnitzer verfasst hatte: „Er ist ein Kerl nach meinem Geschmack / hisst die Fahne der Armen jeden Tag / Geht nie in die Knie / was auch kommen mag / Wenn man mich ruft / Compañero und Presidente Castro zu ehren / erhebe ich mich als Leiche noch / und melde Presente!“ Da würde selbst Erich Honecker blass vor Neid, könnte er es noch.
 Eine muss es hingegen nicht werden, denn sie ist die diesjährige Gewinnerin und wird heute um schlag vier Uhr nachmittags auf der Geschäftsstelle der GBM gewiss mit ähnlicher Lyrik bedacht werden: Felicia Langer (Foto), die 1990 in Israel „ihre Kanzlei aus Protest“ schloss, wie sie selbst sagt, „weil das Justizsystem zur Farce geworden war“, und nach Deutschland übersiedelte, wo sich gerade ein anderes System als Farce entpuppt hatte. Die ostdeutschen Menschenrechtler könnten ihr deshalb, streng genommen, zumindest den Zeitpunkt ihres Wohnortwechsels immer noch übel nehmen. Doch da sie sich hier quasi fühlen wie die Palästinenser im Nahen Osten – entrechtet, erniedrigt und als Bürger zweiter Klasse –, ist es zweifellos ein Zeichen internationaler Solidarität, anlässlich des Tags der Menschenrechte eine Frau auszuzeichnen, die es mit den Unterdrückten hält. Und mal ehrlich: Ist nicht ganz Ostdeutschland ein einziges Beit Hanun? Ist nicht auch die Bundesregierung „in einer Lage, in der nur noch Verhandlungen helfen können, Menschenleben zu retten“? Wäre nicht auch hier eine Zweistaatenlösung das Beste, wenn die neue DDR „nicht mehr als 22 Prozent des historischen“ Deutschland beanspruchte? Fragen wir uns nicht auch: „Was wollt ihr gewinnen mit eurem Staat?“ Geschieht hierzulande nicht auch alles „im Namen unserer Toten, die sich nicht wehren können“? Müssten wir nicht auch aufstehen und sagen: „Aber wir, die Lebenden, wir können uns wehren und klar sagen: Nicht in unserem Namen. Nicht in meinem Namen – das ist Missbrauch der Geschichte“?
Eine muss es hingegen nicht werden, denn sie ist die diesjährige Gewinnerin und wird heute um schlag vier Uhr nachmittags auf der Geschäftsstelle der GBM gewiss mit ähnlicher Lyrik bedacht werden: Felicia Langer (Foto), die 1990 in Israel „ihre Kanzlei aus Protest“ schloss, wie sie selbst sagt, „weil das Justizsystem zur Farce geworden war“, und nach Deutschland übersiedelte, wo sich gerade ein anderes System als Farce entpuppt hatte. Die ostdeutschen Menschenrechtler könnten ihr deshalb, streng genommen, zumindest den Zeitpunkt ihres Wohnortwechsels immer noch übel nehmen. Doch da sie sich hier quasi fühlen wie die Palästinenser im Nahen Osten – entrechtet, erniedrigt und als Bürger zweiter Klasse –, ist es zweifellos ein Zeichen internationaler Solidarität, anlässlich des Tags der Menschenrechte eine Frau auszuzeichnen, die es mit den Unterdrückten hält. Und mal ehrlich: Ist nicht ganz Ostdeutschland ein einziges Beit Hanun? Ist nicht auch die Bundesregierung „in einer Lage, in der nur noch Verhandlungen helfen können, Menschenleben zu retten“? Wäre nicht auch hier eine Zweistaatenlösung das Beste, wenn die neue DDR „nicht mehr als 22 Prozent des historischen“ Deutschland beanspruchte? Fragen wir uns nicht auch: „Was wollt ihr gewinnen mit eurem Staat?“ Geschieht hierzulande nicht auch alles „im Namen unserer Toten, die sich nicht wehren können“? Müssten wir nicht auch aufstehen und sagen: „Aber wir, die Lebenden, wir können uns wehren und klar sagen: Nicht in unserem Namen. Nicht in meinem Namen – das ist Missbrauch der Geschichte“?„Wer, wenn nicht sie?“, räsonnierte die taz im März letzten Jahres anlässlich der Verleihung des Erich-Mühsam-Preises an Felicia Langer und befand, diese „würde die Verhältnisse nie als gegeben hinnehmen“ und habe deshalb „den Preis verdient“. Das kann man wohl sagen – wie auch hinsichtlich der Zuerkennung des Alternativen Nobelpreises 1990 und des Bruno-Kreisky-Preises ein Jahr später. Und natürlich hat sich Langer auch die Ehrung der GBM redlich verdient – selbst wenn man fragen dürfen wird, was an dem israelischen Grenzzaun gegen den palästinensischen Terror eigentlich schlimmer sein soll als an Mauer & Stacheldraht, die einmal für eine deutsche Zweistaatenlösung sorgten. Aber das ist wahrscheinlich zu viel verlangert.