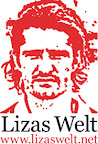Polnische Kontinua
 Dass Antisemitismus in Polen nicht eben eine Randerscheinung ist, um es zurückhaltend zu formulieren, dürfte sich nur schwer bestreiten lassen. Vielmehr hat der Hass gegen Juden in dem osteuropäischen Land eine ausgesprochen lange Tradition, und er mobilisiert bis heute die Ressentiments. Bereits 1267 beschloss das Konzil von Wroclaw, gesonderte, von den Christen getrennte Wohnviertel für Juden zu schaffen, und es zwang letztere zudem, besondere Kennzeichen zu tragen. Während der polnischen Kriege gegen die Ukraine, Russland, Schweden, die Türkei und die Tataren zwischen 1648 und 1717 wurden über 700 jüdische Gemeinden ausgelöscht. Auch in den Jahrzehnten danach kam es immer wieder zu antijüdischen Ausschreitungen und Pogromen, denen Zehntausende Juden zum Opfer fielen. Und als sich Ende des 19. Jahrhunderts in Europa allenthalben nationalistische Ideologien entwickelten und verbreiteten, waren es Roman Dmowski und seine panslawistische und stramm antisemitische Nationaldemokratie (endecja), die vor allem im polnischen Kleinbürgertum auf Resonanz stießen, was insbesondere in den Städten zu antijüdischen Schmierereien, Boykotten jüdischer Geschäfte und Übergriffen führte. Etliche polnische Juden emigrierten daraufhin in westliche Staaten, allen voran in die USA. Doch in der zweiten polnischen Republik setzte sich der Antisemitismus fort, sowohl auf Regierungsebene als auch in der Bevölkerung. Allein in den Jahren 1918 und 1919 gab es rund 130 antijüdische Ausschreitungen, nicht zuletzt das Pogrom von Lvov mit weit über einhundert Toten. Weitere Massenauswanderungen waren die Folge.
Dass Antisemitismus in Polen nicht eben eine Randerscheinung ist, um es zurückhaltend zu formulieren, dürfte sich nur schwer bestreiten lassen. Vielmehr hat der Hass gegen Juden in dem osteuropäischen Land eine ausgesprochen lange Tradition, und er mobilisiert bis heute die Ressentiments. Bereits 1267 beschloss das Konzil von Wroclaw, gesonderte, von den Christen getrennte Wohnviertel für Juden zu schaffen, und es zwang letztere zudem, besondere Kennzeichen zu tragen. Während der polnischen Kriege gegen die Ukraine, Russland, Schweden, die Türkei und die Tataren zwischen 1648 und 1717 wurden über 700 jüdische Gemeinden ausgelöscht. Auch in den Jahrzehnten danach kam es immer wieder zu antijüdischen Ausschreitungen und Pogromen, denen Zehntausende Juden zum Opfer fielen. Und als sich Ende des 19. Jahrhunderts in Europa allenthalben nationalistische Ideologien entwickelten und verbreiteten, waren es Roman Dmowski und seine panslawistische und stramm antisemitische Nationaldemokratie (endecja), die vor allem im polnischen Kleinbürgertum auf Resonanz stießen, was insbesondere in den Städten zu antijüdischen Schmierereien, Boykotten jüdischer Geschäfte und Übergriffen führte. Etliche polnische Juden emigrierten daraufhin in westliche Staaten, allen voran in die USA. Doch in der zweiten polnischen Republik setzte sich der Antisemitismus fort, sowohl auf Regierungsebene als auch in der Bevölkerung. Allein in den Jahren 1918 und 1919 gab es rund 130 antijüdische Ausschreitungen, nicht zuletzt das Pogrom von Lvov mit weit über einhundert Toten. Weitere Massenauswanderungen waren die Folge.Heute leben in Polen etwa 5.000 bis 10.000 Juden. 1939 – bevor die Wehrmacht das Land überfiel – waren es 3,35 Millionen, 1945 noch 50.000. Im von den Deutschen besetzten Polen befanden sich die großen Vernichtungslager: Auschwitz, Treblinka, Sobibor, Majdanek, Chelmno und Belzec. Dort ermordeten die Nationalsozialisten etwa die Hälfte der insgesamt sechs Millionen Juden. Doch die Shoa habe „im kollektiven Bewusstsein Polens vierzig Jahre lang kaum Spuren hinterlassen, und der Antisemitismus ist von diesem Ereignis nahezu unberührt geblieben“, konstatiert der Historiker Lutz Eichler, und Raul Hilberg erläutert: „Aus der Sicht des Großteils der Polen waren die Juden, obwohl sie immer wieder ihre Loyalität zum polnischen Staat beteuerten, nicht fähig, den Geist und die Sehnsüchte des polnischen Volks zu verstehen. Mit Beginn der Okkupation vertiefte sich die Kluft.“ Diese Sehnsüchte und ihre Hintergründe beschreibt der Münchner Historiker Chaim Frank so:
„In der polnischen Bevölkerung mischte sich stets der religiöse Antisemitismus mit dem Antikommunismus, der in enger Verbindung zur polnisch-russischen Geschichte stand: War das unterdrückende Regime früher das zaristische, später das stalinistische, so wurde die Schuld an der feudalistischen wie kommunistischen Herrschaft den Juden zugeschrieben, die überdies auch den Christensohn ‚ermordetet’ hatten. Dieses stereotype Judenbild hat [...] – ungebrochen aller Geschehnisse – bis heute seine Gültigkeit in Polen und wurde im Verlauf der Nachkriegsjahre weiter manifestiert. In ihrer judäo-kommunistischen Phobie betrachten sich die meisten Polen als ‚Opfer’ eines anti-polnischen Komplottes und sehnen sich in jene Zeit der Großpolnischen Ära zurück, wo die polnische Grenze noch weit bis in die heutige Ukraine hineinreichte.“Lutz Eichler benennt weitere Gründe, warum selbst die Shoa an all dem nichts zu ändern vermochte:
„Während im Land der Täter der Antisemitismus gewissermaßen ‚durch Auschwitz hindurch muss’ und sich dabei zu dem spezifischen sekundären Antisemitismus transformierte (‚Die Deutschen verzeihen den Juden Auschwitz nie’), blieb er im polnischen öffentlichen Diskurs stets präsent. Das lag zunächst an der anderen symbolischen Aufladung von Auschwitz, das von den Staatskommunisten als Ort des Martyriums des polnischen Volkes und insbesondere seines antifaschistischen Widerstandes umgedeutet wurde und der Legitimation des volksrepublikanischen Staatsprojekts diente. Noch in dem 1988 erschienenen offiziellen Standardwerk der Gedenkstätte Auschwitz (Interpress Verlag) heißt es: ‚Die KZ waren das Hauptinstrument zur [...] Vernichtung der unterjochten Völker, vor allem der slawischen, darunter besonders des polnischen Volkes und der Völker der UdSSR, sowie der Juden und der Menschen, die nach den Nürnberger Gesetzen von 1935 als Juden angesehen wurden’.“Und die nationalen Mythen des katholischen Landes bestehen auch nach dem Ende des Realsozialismus fort, der seinerseits mit militanten Kampagnen gegen „Zionisten“ und „Agenten des Weltjudentums“ die antisemitischen Traditionen in Polen konsequent weiterentwickelt hatte. Bei diesen Mythen spielt der Katholizismus eine tragende Rolle, wie Eichler weiß:
„Der polnische Nationalismus speist sich aus der Überzeugung einer kollektiven Märtyrer- und Messias-Rolle, die ein Opfer neben sich nicht duldet. Das nationalistische Sendungsbewusstsein hat eine religiöse Tiefe, die die lange Zeit verzögerte Nationenbildung mythisch auflädt. Die Dreiteilung Polens durch die Großmächte wird als heilige Dreifaltigkeit interpretiert, der polenfeindlichen Politik der Teilungsmächte wird der ehrenvolle Märtyrertod entgegengesetzt, der über den Widerstand zur ‚Auferstehung’ des ‚Christus der Völker’ führen müsse. Die Vorstellung, zum auserwählten Volk zu gehören, wird durch die schiere Präsenz ‚der Juden’, aber darüber hinaus durch die vermeintliche jüdische Reklamierung von Auschwitz als Martyrium, empfindlich gestört.“Deshalb war die Entrüstung auch groß, als 2002 der von polnischen Antisemiten ins Werk gesetzte Massenmord an den jüdischen Einwohnern der polnischen Kleinstadt Jedwabne bekannt wurde, denen Kollaboration mit der Sowjetunion gegen Polen vorgeworfen worden war – eine Verbindung aus traditionellen antisemitischen Feindbildern mit dem des „jüdischen Kommunisten“ – und die man in einer Scheune zusammengetrieben und verbrannt hatte. Die deutschen Besatzer hatten dabei fraglos erst die Voraussetzung für das Pogrom geschaffen: Ihre Herrschaft war unumschränkt; sie hätten es daher jederzeit stoppen können. Durch die Zusicherung der Straffreiheit ermunterten die Nationalsozialisten die polnischen Täter; alles Weitere lag in deren Händen. Es handelte sich also weniger um Kollaboration im engeren Sinne, sondern um eine originär polnische antisemitische Tat. Das Pogrom von Jedwabne gehört weniger zur Geschichte der Shoa als vielmehr zur Geschichte des Antisemitismus in Polen.
 Der wiederum ist beständig bis in die Gegenwart – auch in personeller Hinsicht. Und hier ist nicht zuletzt die Familie Giertych zu nennen, die „mit ihrem publizistischen Werk ein ideologisches Kontinuum“ bildet, wie Ulrich M. Schmid in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) feststellte, „das zwar unterschiedliche Ausprägungen aufweist, aber klar als Einheit wahrnehmbar ist. Großvater, Vater und Sohn Giertych berufen sich in ihrem politischen Credo vor allem auf zwei Autoren: auf den nationaldemokratischen Politiker Roman Dmowski“ – samt seiner „endecja“ – und auf den katholischen Historiosophen Feliks Koneczny“. Letzterer lebte von 1862 bis 1949 , „propagierte eine reine polnische Zivilisation, die sich vom ‚byzantinischen’ Deutschland und vom ‚turanischen’ Russland abzugrenzen hätte“, und hielt Juden für Parasiten. Daran knüpften die Giertychs an; im Zentrum ihres Denkens „stehen der Katholizismus, der Antieuropäismus und Verschwörungstheorien“, befand Schmid. Großvater Jedrzej (1903–1992, Foto) habe Adolf Hitler für eine ambivalente Figur gehalten, denn dieser habe einerseits „das für Polen gefährliche Preußentum gemildert, außerdem seien nun die beiden Hauptfeinde Polens, die Deutschen und die Juden, getrennt“; darüber hinaus habe er „die Nation geeint, seine Heimat ‚entjudet’ und für bürgerlichen Wohlstand gesorgt“. Andererseits, so befürchtete Jedrzej Giertych, könne der Erbfeind Deutschland Polen in jedem Augenblick überfallen. „In literarisierter Form lassen sich Jedrzej Giertychs Angstfantasien in einem Roman mit dem reißerischen Titel ‚Der Anschlag’ (1938) nachlesen“, schrieb der NZZ-Journalist:
Der wiederum ist beständig bis in die Gegenwart – auch in personeller Hinsicht. Und hier ist nicht zuletzt die Familie Giertych zu nennen, die „mit ihrem publizistischen Werk ein ideologisches Kontinuum“ bildet, wie Ulrich M. Schmid in der Neuen Zürcher Zeitung (NZZ) feststellte, „das zwar unterschiedliche Ausprägungen aufweist, aber klar als Einheit wahrnehmbar ist. Großvater, Vater und Sohn Giertych berufen sich in ihrem politischen Credo vor allem auf zwei Autoren: auf den nationaldemokratischen Politiker Roman Dmowski“ – samt seiner „endecja“ – und auf den katholischen Historiosophen Feliks Koneczny“. Letzterer lebte von 1862 bis 1949 , „propagierte eine reine polnische Zivilisation, die sich vom ‚byzantinischen’ Deutschland und vom ‚turanischen’ Russland abzugrenzen hätte“, und hielt Juden für Parasiten. Daran knüpften die Giertychs an; im Zentrum ihres Denkens „stehen der Katholizismus, der Antieuropäismus und Verschwörungstheorien“, befand Schmid. Großvater Jedrzej (1903–1992, Foto) habe Adolf Hitler für eine ambivalente Figur gehalten, denn dieser habe einerseits „das für Polen gefährliche Preußentum gemildert, außerdem seien nun die beiden Hauptfeinde Polens, die Deutschen und die Juden, getrennt“; darüber hinaus habe er „die Nation geeint, seine Heimat ‚entjudet’ und für bürgerlichen Wohlstand gesorgt“. Andererseits, so befürchtete Jedrzej Giertych, könne der Erbfeind Deutschland Polen in jedem Augenblick überfallen. „In literarisierter Form lassen sich Jedrzej Giertychs Angstfantasien in einem Roman mit dem reißerischen Titel ‚Der Anschlag’ (1938) nachlesen“, schrieb der NZZ-Journalist:„Die Handlung ist einfach gestrickt: Jüdische Verschwörer führen in Polen eine Revolution durch und verüben Anschläge auf Universitäten, Bischofssitze und Kirchen. Die Revolutionäre bilden eine provisorische Regierung, errichten eine Föderation nach Schweizer Vorbild und nennen den neuen Staat ‚Judaeo-Polonia’. In letzter Minute gelingt es allerdings, die Revolutionäre aus dem Land zu vertreiben. Giertychs Roman endet mit einer hehren Glücksvision: ‚Und plötzlich erblickten wir das wahre Polen. Dies wurde möglich durch die Befreiung Polens von den Juden.’“Jedrzejs 1936 geborener Sohn Maciej Giertych wiederum (Foto unten, links), Biologieprofessor an der Polnischen Akademie der Wissenschaften, feiere den faschistischen Diktator Francisco Franco als Verteidiger des katholischen Spaniens und glaube, Polen werde heute von Freimaurern bedroht:
„Die EU sei nur der Anfang des freimaurerischen Projekts der Errichtung einer Weltherrschaft. Als einzelne Elemente dieser Verschwörung nennt er die Bedrohung der lateinischen Zivilisation, die Vermischung der Rassen, den Atheismus, den Bevölkerungsrückgang und schließlich die Verlockungen der Sozialfürsorge. In der Homosexualität erblickt Maciej Giertych, der sich beruflich mit der Genetik von Bäumen befasst, eine ernsthafte Gefahr für die polnische Bevölkerung, da sie die Fortpflanzung der Nation behindere. Homosexualität stelle eine Aberration dar, die aber therapierbar sei.“
 Auch Roman Giertych (Foto, rechts), Jahrgang 1971, polnischer Vizepremier, Bildungsminister und Maciejs Abkömmling, ist dieser Ansichten. Wie sein Vater gehört er der rechtsradikalen Liga der polnischen Familien (LPR) an; beide bezweifeln wie ihre Partei öffentlich die Evolutionstheorie und plädieren für eine Integration des Kreationismus in die Lehrpläne polnischer Schulen – was insbesondere bei vielen Schülern und deren Lehrern für heftige Proteste sorgt. Und damit nicht genug: Eine Vorfeldorganisation der katholischen Kirche darf auf Geheiß Roman Giertychs seit kurzem die Internetfilter in den Schulcomputern installieren; darüber hinaus wird mit einem neuen Schulfach namens „Patriotische Erziehung“ an der nationalistischen Indoktrination der Schülerschaft gearbeitet. Und sogar körperliche Züchtigungen von renitenten Schülern werden von der LPR ernsthaft in Erwägung gezogen. „Alle Giertychs verfolgen eine fundamentalistische Linie und lehnen die Liberalisierung des Priesteramts, eine ökumenische Öffnung, Verhütung, Fristenregelung, Scheidung und Homosexualität kompromisslos ab“, fasste Ulrich M. Schmid einige familiäre Gemeinsamkeiten zusammen.
Auch Roman Giertych (Foto, rechts), Jahrgang 1971, polnischer Vizepremier, Bildungsminister und Maciejs Abkömmling, ist dieser Ansichten. Wie sein Vater gehört er der rechtsradikalen Liga der polnischen Familien (LPR) an; beide bezweifeln wie ihre Partei öffentlich die Evolutionstheorie und plädieren für eine Integration des Kreationismus in die Lehrpläne polnischer Schulen – was insbesondere bei vielen Schülern und deren Lehrern für heftige Proteste sorgt. Und damit nicht genug: Eine Vorfeldorganisation der katholischen Kirche darf auf Geheiß Roman Giertychs seit kurzem die Internetfilter in den Schulcomputern installieren; darüber hinaus wird mit einem neuen Schulfach namens „Patriotische Erziehung“ an der nationalistischen Indoktrination der Schülerschaft gearbeitet. Und sogar körperliche Züchtigungen von renitenten Schülern werden von der LPR ernsthaft in Erwägung gezogen. „Alle Giertychs verfolgen eine fundamentalistische Linie und lehnen die Liberalisierung des Priesteramts, eine ökumenische Öffnung, Verhütung, Fristenregelung, Scheidung und Homosexualität kompromisslos ab“, fasste Ulrich M. Schmid einige familiäre Gemeinsamkeiten zusammen.Zu denen gehört wesentlich aber auch der Antisemitismus, und zum Beweis dessen hat Maciej Giertych nun neuerlich für einen Skandal gesorgt. Der 70-jährige, der für die LPR im Europaparlament sitzt, stellte just dort vergangene Woche eine 32-seitige Broschüre mit dem Titel „Civilisations at war in Europe“ („Zivilisationen im Krieg in Europa“) vor, in der es unter anderem heißt: „Die jüdische Zivilisation lässt sich bei anderen Zivilisationen nieder, mit Vorliebe bei reichen. Sie tendiert dazu, von ärmeren in reichere Länder auszuwandern“ und sei „auf Trennung und Differenzierung von den umgebenden Gemeinschaften aufgebaut“. Juden zögen es vor, „ein getrenntes Leben in Apartheid von den umgebenden Gemeinschaften zu leben“: „Sie bilden ihre eigenen Gemeinden (Kahals), sie regieren sich selbst nach ihren eigenen Regeln, und sie achten darauf, auch eine räumliche Trennung beizubehalten. Sie bilden ihre Ghettos selbst, als Bezirke, in denen sie zusammen wohnen, vergleichbar den Chinatowns in den USA.“ Durch all dies hätten sie „biologische Unterschiede“ entwickelt; Polen und andere Teile Europas mit einem „katholischen Herzen“ könnten daher nicht mit einer „Torah-basierten Zivilisation“ koexistieren.
Der Europäische Jüdische Kongress (EJC) verurteilte Maciej Giertychs Schrift als „antisemitisches Pamphlet“, in dem „die Rassentheorien der Vorkriegszeit verwendet werden, die zum Holocaust geführt haben“; der EJC drohte mit rechtlichen Schritten und forderte, dass die Kosten für die Publikation rückvergütet werden, sofern sie aus Mitteln der Europäischen Union bestritten wurden. Auch die polnische Organisation Nigdy Wiecej (Nie wieder) protestierte scharf, und die Sozialdemokraten im Europaparlament forderten eine Untersuchung. Maciej Giertych jedoch hat nichts zurückzunehmen. Zwar drücke die Broschüre nicht seine eigenen Gedanken aus, sondern die Philosophie des – bereits erwähnten – Feliks Koneczny; gleichwohl unterstütze er dessen Lehren: „Sie sind sehr gute Ideen, und man sollte ihnen folgen. Ich schließe mich seinen Methoden an“, sagte der ältere Giertych.
Noch Fragen?