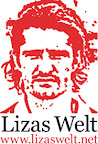Renaissance eines Gesinnungstextils
 Bis vor kurzem konnte man berechtigte Hoffnungen hegen, das schwarz-weiße Elend hierzulande endlich los zu sein. Doch dann entdeckten plötzlich die Modeschöpfer die Kafiya – das so genannte Palästinensertuch also –, und seitdem ist man für den Erwerb dieses Textils nicht mehr auf fliegende Händler, palästinensische Gemeinden oder stickige Infoläden angewiesen, sondern kann es problemlos in allen großen Kaufhäusern von der Stange nehmen oder bei amazon bestellen (wo es sowohl in der Rubrik „Küche und Haushalt“ als auch in der Sparte „Garten und Freizeit“ geführt wird). Ganze Heerscharen von pubertierenden Jugendlichen wickeln sich nun die Kopfwindel um ihren Hals, weshalb zahlreiche deutsche Innenstädte derzeit das morbide Flair einer Palästina-Solidaritätsdemo verströmen. Dass viele Träger dieses so sperrigen wie speihässlichen Kleidungsstücks angeblich oder tatsächlich nicht wissen, was für ein Accessoire sie da spazieren führen, macht die Sache nur noch schlimmer.
Bis vor kurzem konnte man berechtigte Hoffnungen hegen, das schwarz-weiße Elend hierzulande endlich los zu sein. Doch dann entdeckten plötzlich die Modeschöpfer die Kafiya – das so genannte Palästinensertuch also –, und seitdem ist man für den Erwerb dieses Textils nicht mehr auf fliegende Händler, palästinensische Gemeinden oder stickige Infoläden angewiesen, sondern kann es problemlos in allen großen Kaufhäusern von der Stange nehmen oder bei amazon bestellen (wo es sowohl in der Rubrik „Küche und Haushalt“ als auch in der Sparte „Garten und Freizeit“ geführt wird). Ganze Heerscharen von pubertierenden Jugendlichen wickeln sich nun die Kopfwindel um ihren Hals, weshalb zahlreiche deutsche Innenstädte derzeit das morbide Flair einer Palästina-Solidaritätsdemo verströmen. Dass viele Träger dieses so sperrigen wie speihässlichen Kleidungsstücks angeblich oder tatsächlich nicht wissen, was für ein Accessoire sie da spazieren führen, macht die Sache nur noch schlimmer.Dabei muss man gar keine Bücher wälzen, um etwas über die Geschichte und Gegenwart der Kafiya zu erfahren; eine simple Google-Suche genügt bereits. Schon die erste Seite liefert bei der Eingabe des Begriffs „Palästinensertuch“ (wahlweise auch „Palituch“) ausreichend Treffer, um wenigstens den Anflug einer Ahnung davon zu bekommen, welche historische und aktuelle Bedeutung dieser Stofffetzen hat. Bei den virtuellen Fundstücken stößt man rasch auch auf die beiden Flugblatt-Klassiker „Coole Kids tragen kein Pali-Tuch“ und „Ist dir kalt oder hast du was gegen Juden?“, die zwar teilweise etwas arg pädagogisch aufgezogen sind, aber trotzdem wesentliche Informationen bereithalten: Der tischdeckengroße Wickel war zu allen Zeiten ein Symbol für den Kampf gegen „die Juden“ und „den Westen“; zwischen 1936 und 1939 wurde er außerdem vom Mufti von Jerusalem, einem Verbündeten der Nationalsozialisten, mit unmittelbarem Zwang in der Bevölkerung durchgesetzt. Ende der sechziger Jahre schleppte ihn dann der Sozialistische Deutsche Studentenbund (SDS) nach Deutschland ein, und fortan war er Ausdruck der Solidarisierung der Linken mit den gegen „das zionistische Gebilde“ Israel kämpfenden Palästinensern – und überhaupt ein Zeichen für die Sympathie mit den gegen „den Imperialismus“ Front machenden „unterdrückten Völkern“.
 Später mutierte das „Palituch“ zum Ausweis eines allgemeinen Links- und Dagegenseins; auf Anti-Akw-Demonstrationen wurde es genauso zahlreich getragen wie bei Friedensmärschen, an der Startbahn West oder bei Kundgebungen gegen die Schließung eines Hörsaals. Es war ein Gesinnungstextil, das gleichwohl einen Ursprung hatte – ob dieser seinen Trägern nun bewusst war oder nicht – und dadurch in jeglichem Protest (gegen wen oder was auch immer) stets eine zentrale Botschaft transportierte: „Freiheit für Palästina“, also „Juden raus“. Unter den Linken war dieser Antizionismus nahezu unumstrittener Konsens, und erst in den neunziger Jahren büßte das vor allem mit Yassir Arafat assoziierte Stück gemusterter Baumwolle in Deutschland allmählich an Popularität ein – nicht zuletzt infolge der Spaltung der Linken und der damit verbundenen Entstehung nichtjüdischer pro-israelischer Gruppen, die vehement Position gegen den Antisemitismus in den vormals eigenen Reihen bezogen. Im Zuge dessen entstanden auch die bereits erwähnten Flugschriften sowie weitere Aufklärungspapiere zum „Palästinensertuch“, und wer trotzdem noch den Feudel am Hals hatte, durfte jetzt erst recht als unbelehrbar und ausgewiesener Überzeugungstäter gelten.
Später mutierte das „Palituch“ zum Ausweis eines allgemeinen Links- und Dagegenseins; auf Anti-Akw-Demonstrationen wurde es genauso zahlreich getragen wie bei Friedensmärschen, an der Startbahn West oder bei Kundgebungen gegen die Schließung eines Hörsaals. Es war ein Gesinnungstextil, das gleichwohl einen Ursprung hatte – ob dieser seinen Trägern nun bewusst war oder nicht – und dadurch in jeglichem Protest (gegen wen oder was auch immer) stets eine zentrale Botschaft transportierte: „Freiheit für Palästina“, also „Juden raus“. Unter den Linken war dieser Antizionismus nahezu unumstrittener Konsens, und erst in den neunziger Jahren büßte das vor allem mit Yassir Arafat assoziierte Stück gemusterter Baumwolle in Deutschland allmählich an Popularität ein – nicht zuletzt infolge der Spaltung der Linken und der damit verbundenen Entstehung nichtjüdischer pro-israelischer Gruppen, die vehement Position gegen den Antisemitismus in den vormals eigenen Reihen bezogen. Im Zuge dessen entstanden auch die bereits erwähnten Flugschriften sowie weitere Aufklärungspapiere zum „Palästinensertuch“, und wer trotzdem noch den Feudel am Hals hatte, durfte jetzt erst recht als unbelehrbar und ausgewiesener Überzeugungstäter gelten.Die Modedesigner scherte das jedoch einen feuchten Kehricht, und so erlebt die in jeder Hinsicht scheußliche Halskrause (daran ändert sich auch nichts, wenn sie in knalligen Farben daherkommt) derzeit ein fulminantes Comeback. Nur wenige stören sich daran, wie etwa die 23jährige Steffi Gratzke*, die sich im Kölner Stadt-Anzeiger wunderte: „Zuletzt thronte dieser Stoff nur auf dem alternden Haupt des inzwischen verstorbenen Yassir Arafat. Und plötzlich soll das Tuch der letzte Schrei aus Hollywood sein? Das passende Zubehör zu Röhrenjeans und gesteppter Ledertasche?“ Zumindest wird das augenscheinlich nicht als ästhetischer Widerspruch begriffen. Und selbst die Tatsache, dass längst auch die Neonazis den Lappen zur Schau stellen – sehr zu Recht übrigens –, tut dem Trend keinerlei Abbruch. Denn dem „Palituch“ eilt noch immer der Ruf voraus, ein Symbol für Rebellion und Nonkonformismus zu sein. Und dass dieses Image sich über all die Jahre und Jahrzehnte konservieren konnte, statt als Signum des genauen Gegenteils – nämlich einer durch und durch konformistischen Rebellion antisemitischer Mordsgesellen und ihrer fünften Kolonne – auf dem Müllhaufen der Geschichte entsorgt zu werden, spricht Bände.
 Dies umso mehr, als der Moment der Wiederkehr des gescheckten Stoßdämpfers fürwahr bemerkenswert ist: „Es entbehrt nicht einer grausigen Ironie, dass zu einem Zeitpunkt, da sich der palästinensische Selbst- und Fremdvernichtungswahn besonders sinnfrei austobt, das Bekenntnistextil für diesen Wahn ganz neue Fans in Deutschland gewinnt“, befand Marcus Hammerschmitt zu Recht. Nun mag der Textilfachhandel tatsächlich zuvörderst „dankbar für den schnellen Euro“ sein, „den er mit ahnungslosen Kindern machen kann“, wie Hammerschmitt schrieb. Aber er muss eben auch die einigermaßen gesicherte Erwartung haben, dass ein entsprechender Markt überhaupt vorhanden ist – und dass der nur von Kenntnislosen bedient wird, darf zumindest bezweifelt werden. Immerhin hat das Angebot eines solch explizit politischen Produktes die mutmaßliche Akzeptanz oder wenigstens die stillschweigende Hinnahme von dessen originärer Bedeutung zur Voraussetzung. Schließlich wissen selbst die Zwölfjährigen, dass das Ding irgendetwas mit „den Palästinensern“ zu tun hat und dass diese Palästinenser, so viel ist sicher, allemal für gerechtfertigten Protest und legitimes Aufbegehren stehen.
Dies umso mehr, als der Moment der Wiederkehr des gescheckten Stoßdämpfers fürwahr bemerkenswert ist: „Es entbehrt nicht einer grausigen Ironie, dass zu einem Zeitpunkt, da sich der palästinensische Selbst- und Fremdvernichtungswahn besonders sinnfrei austobt, das Bekenntnistextil für diesen Wahn ganz neue Fans in Deutschland gewinnt“, befand Marcus Hammerschmitt zu Recht. Nun mag der Textilfachhandel tatsächlich zuvörderst „dankbar für den schnellen Euro“ sein, „den er mit ahnungslosen Kindern machen kann“, wie Hammerschmitt schrieb. Aber er muss eben auch die einigermaßen gesicherte Erwartung haben, dass ein entsprechender Markt überhaupt vorhanden ist – und dass der nur von Kenntnislosen bedient wird, darf zumindest bezweifelt werden. Immerhin hat das Angebot eines solch explizit politischen Produktes die mutmaßliche Akzeptanz oder wenigstens die stillschweigende Hinnahme von dessen originärer Bedeutung zur Voraussetzung. Schließlich wissen selbst die Zwölfjährigen, dass das Ding irgendetwas mit „den Palästinensern“ zu tun hat und dass diese Palästinenser, so viel ist sicher, allemal für gerechtfertigten Protest und legitimes Aufbegehren stehen.Dabei schockt hierzulande keinen Erwachsenen mehr, wer sich mit dem ausladenden Lumpen drapiert. Denn in einem Land, in dem 68,3 Prozent der Ansicht sind, dass Israel einen „Vernichtungskrieg gegen die Palästinenser“ führt und sogar 81,9 Prozent „wütend werden“, wenn sie „daran denken, wie Israel die Palästinenser behandelt“, ist das „Palituch“ längst ein mehrheitlich vollkommen akzeptiertes Kleidungsstück. Im Zweifelsfall muss dessen Kauf noch nicht einmal vom Taschengeld abgeknapst werden, weil die Eltern derlei Halsschmuck ausdrücklich gutheißen und höchst freiwillig finanzieren – zumal dann, wenn es in Warenhäusern feil geboten wird, in denen sie selbst verkehren. Mit den herkömmlichen Antisemitismustheorien kommt man dem Ganzen übrigens ganz gewiss nicht bei. Aber mit der Frage „Ist dir kalt, oder hast du was gegen Juden?“ erntet man zumindest einen Moment hektischer Verunsicherung.
* Der Nachname ist im Kölner Stadt-Anzeiger falsch geschrieben.
Eine gekürzte Fassung dieses Beitrags ist am 17. Dezember in der österreichischen Tageszeitung Die Presse erschienen.