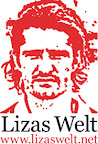Eine deutsche Affäre
 Die Empörung über die Trauerrede, die Günther Oettinger auf Hans Filbinger (Foto), einen seiner Vorgänger im Amt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, gehalten hat, ist in weiten Teilen so bigott wie wohlfeil. Denn Oettinger hat bloß versucht, dem deutschen Geschichtsverständnis eines Nationalsozialismus ohne Nazis gerecht zu werden, also im Kern nichts anderes vertreten als das, was nicht wenige seiner jetzigen Kritiker zu staatstragender Stunde regelmäßig von sich geben. Sein Versuch, einen Funktionsträger des NS-Staates zum Widerstandskämpfer zu machen, kam allerdings ein bisschen zu früh und entpuppte sich daher als kontraproduktiv – in einem grundsätzlichen Widerspruch zu dem Ansinnen des postnazistischen Deutschlands, sich als geläutert und mit sich selbst im Reinen zu begreifen, stand er jedoch nicht.
Die Empörung über die Trauerrede, die Günther Oettinger auf Hans Filbinger (Foto), einen seiner Vorgänger im Amt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, gehalten hat, ist in weiten Teilen so bigott wie wohlfeil. Denn Oettinger hat bloß versucht, dem deutschen Geschichtsverständnis eines Nationalsozialismus ohne Nazis gerecht zu werden, also im Kern nichts anderes vertreten als das, was nicht wenige seiner jetzigen Kritiker zu staatstragender Stunde regelmäßig von sich geben. Sein Versuch, einen Funktionsträger des NS-Staates zum Widerstandskämpfer zu machen, kam allerdings ein bisschen zu früh und entpuppte sich daher als kontraproduktiv – in einem grundsätzlichen Widerspruch zu dem Ansinnen des postnazistischen Deutschlands, sich als geläutert und mit sich selbst im Reinen zu begreifen, stand er jedoch nicht.Jahrzehnte lang dominierte in der Bundesrepublik der Versuch, die Shoa zu historisieren – das präzedenzlose Menschheitsverbrechen also in einem größeren Kontext auf-, das heißt untergehen zu lassen, etwa in einem „europäischen Bürgerkrieg“ (Ernst Nolte) – und sie mit dem deutschen Leiden an „Vertreibung“ und „Bombenkrieg“ zu verrechnen. In der DDR und der westdeutschen Linken wurden Vernichtungskrieg und Judenmord derweil den „Verbrechen des Imperialismus“ eingemeindet. Wenn auch die Vorzeichen unterschiedliche waren: Beide Herangehensweisen abstrahierten von den Spezifika des Nationalsozialismus und bagatellisierten ihn auf diese Weise. Mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus und der damit verbundenen Revision der Nachkriegsordnung bildete sich allmählich eine neue Geschichtspolitik heraus, die unter Rot-Grün zu voller Blüte gelangte: Frei von den Fesseln eingeschränkter staatlicher Souveränität und nicht mehr unter alliierter Aufsicht stehend, mutierte die Bürde der Vergangenheit zunehmend zur selbst auferlegten Verpflichtung, das Nie wieder! allerorten handfest werden zu lassen: Joseph Fischers mit sorgenzerfurchtem Gesicht vorgetragenes Diktum, man habe im Kosovo ein „zweites Auschwitz“ zu verhindern, zeugt ebenso davon wie Schröders antiamerikanische Invektiven gegen den Sturz des Saddam-Regimes.
Aus der Last der Geschichte wurde die Lust auf Geschichte made in Germany: Der Mythos von der „sauberen Wehrmacht“ ging mit dem Stahlhelmflügel der CDU unter, denn weit zukunftsträchtiger als das nationalkonservative Beharren darauf, dass die Deutschen doch über all die Jahre ihres Daseins anständige Menschen geblieben seien und ihre Geschichte mehr vorzuweisen habe als die Jahre zwischen dreiunddreißig und fünfundvierzig, schien das Bekenntnis zur Vergangenheit zu sein. Die musste nun perpetuiert werden, wollte man doch mit dem Verweis auf sie die eigene Läuterung umso nachdrücklicher inszenieren. Als Folge dessen entstand nicht zuletzt das Holocaust-Mahnmal in Berlin, das als nationales Symbol die Neue Wache ablöste: Zu ihm solle man gerne gehen, fand Gerhard Schröder; das größte Mahnmal der Welt – das es ohne den größten Massenmord der Weltgeschichte nicht gäbe – kündet mitten in der deutschen Hauptstadt monumental von den Lehren der Geschichte, und die Stelenspringer demonstrieren auf ihm die neue deutsche Unbeschwertheit, Marke Fanmeile. Am 8. Mai 2005, dem sechzigsten Jahrestag der Kapitulation, feierte Deutschland mit unzähligen Veranstaltungen die Befreiung – nicht die der überlebenden Juden, Zwangsarbeiter, Roma und Sinti von der deutschen Barbarei wohlgemerkt, sondern die Befreiung der Deutschen vom Nationalsozialismus, was allemal voraussetzt, sich respektive die Vorfahren als Opfer zu begreifen und nicht als Täter.
Und darin haben die Deutschen Übung, nur hat sich ihre Vorgehensweise bei der Selbsteinopferung verändert: Heute gehört es im Unterschied zu früheren Zeiten zum guten Ton, etwa die Ausweisung der Deutschen aus Osteuropa pflichtschuldigst als Folge des von den Nationalsozialisten begonnenen Krieges darzustellen – um sich durch diese Vorleistung desto mehr im Recht zu fühlen, Flucht & Vertreibung als universelle Menschheitsverbrechen zu beziffern, unter denen zuvörderst die eigenen Eltern und Großeltern gelitten hätten. „In der üblichen Behauptung, das eine Leiden, das deutsche nämlich, nicht mit dem anderen aufrechnen zu wollen, ist die halbe Volte der Neudeutung von Geschichte bereits gelungen: Leiden als Schicksal hier wie dort; und wo von Schicksal die Rede ist, wird nach dem Grund, nach der Bedeutung individuellen Handelns, nach kollektiver Verantwortung und individueller Schuld kaum mehr gefragt. Doch: Wo überall nur noch Opfer sind, da drängt sich die Frage auf, wer die Taten dann überhaupt beging“, schrieb Hector Calvelli anlässlich des TV-Rührstücks Die Flucht, in dem selbst der ostpreußischen Adel als von den Nazis verfolgt, auf eine Stufe mit Zwangsarbeitern gestellt und somit exkulpiert wurde. Ja, wo sind sie denn, die Täter? Und wer sind sie? Ein paar hat man nach Nürnberg aufgehängt, aber sonst?
 Sonst scheint es keine gegeben zu haben, denn da waren schließlich die „Zwänge des Regimes“, denen sich Millionen „nicht entziehen“ konnten. Sie lebten – das dürfen „wir als Nachgeborene nie vergessen“ – „damals unter einer brutalen und schlimmen Diktatur“ und mussten gegen ihren Willen Dinge tun, die sie aus eigenem Antrieb selbstverständlich nie getan hätten. Sie hatten nämlich entweder keine „Entscheidungsmacht“ oder keine „Entscheidungsfreiheit“, was umso ärger ist, als sie doch eigentlich „Gegner des NS-Regimes“ waren, wenngleich sie „nicht die Kraft zu offenem Widerstand“ hatten und deshalb in ihrer Not in die NSDAP, die SA oder die SS eintraten, bevor es die Nazis taten. Dort retteten sie Menschenleben; zumindest wäre ohne sie alles noch schlimmer gekommen. Jedenfalls haben sie nichts unternommen, wodurch „ein Mensch sein Leben verloren hätte“. Das alles sagte Günther Oettinger (Foto) über Hans Filbinger – und damit im Grundsatz nichts, was im postnazistischen Deutschland nicht ohnehin schon weitgehende Zustimmung hervorriefe. Dem dieser Sichtweise zugrunde liegenden Paradoxon eines Nationalsozialismus ohne Nationalsozialisten sind bereits Harald Welzer, Sabine Moller und Karoline Tschuggnall in ihrem Buch Opa war kein Nazi nachgegangen, und was sie herausfanden, passt exakt zu Oettingers Rede: Die Kinder und Enkel verfügen über eine ganze Menge an historischem Wissen über Vernichtungskrieg und Holocaust, aber: Die Nazis, das waren die anderen – in der eigenen Familie hatte man schließlich etwas gegen sie, selbst respektive erst recht, wenn die Vorfahren das gar nicht behaupten. Willige Vollstrecker, das geigte man dereinst schon dem frechen Goldhagen, konnten die Deutschen jedenfalls nicht gewesen sein.
Sonst scheint es keine gegeben zu haben, denn da waren schließlich die „Zwänge des Regimes“, denen sich Millionen „nicht entziehen“ konnten. Sie lebten – das dürfen „wir als Nachgeborene nie vergessen“ – „damals unter einer brutalen und schlimmen Diktatur“ und mussten gegen ihren Willen Dinge tun, die sie aus eigenem Antrieb selbstverständlich nie getan hätten. Sie hatten nämlich entweder keine „Entscheidungsmacht“ oder keine „Entscheidungsfreiheit“, was umso ärger ist, als sie doch eigentlich „Gegner des NS-Regimes“ waren, wenngleich sie „nicht die Kraft zu offenem Widerstand“ hatten und deshalb in ihrer Not in die NSDAP, die SA oder die SS eintraten, bevor es die Nazis taten. Dort retteten sie Menschenleben; zumindest wäre ohne sie alles noch schlimmer gekommen. Jedenfalls haben sie nichts unternommen, wodurch „ein Mensch sein Leben verloren hätte“. Das alles sagte Günther Oettinger (Foto) über Hans Filbinger – und damit im Grundsatz nichts, was im postnazistischen Deutschland nicht ohnehin schon weitgehende Zustimmung hervorriefe. Dem dieser Sichtweise zugrunde liegenden Paradoxon eines Nationalsozialismus ohne Nationalsozialisten sind bereits Harald Welzer, Sabine Moller und Karoline Tschuggnall in ihrem Buch Opa war kein Nazi nachgegangen, und was sie herausfanden, passt exakt zu Oettingers Rede: Die Kinder und Enkel verfügen über eine ganze Menge an historischem Wissen über Vernichtungskrieg und Holocaust, aber: Die Nazis, das waren die anderen – in der eigenen Familie hatte man schließlich etwas gegen sie, selbst respektive erst recht, wenn die Vorfahren das gar nicht behaupten. Willige Vollstrecker, das geigte man dereinst schon dem frechen Goldhagen, konnten die Deutschen jedenfalls nicht gewesen sein.Und so betrauert man inzwischen am 27. Januar oder am 9. November die toten Juden – mit den (über)lebenden hat man es nur dann, wenn sie sich als Israelkritiker ausweisen können –, begeht am 1. September den Antikriegstag, erkennt Adolf Hitler (einem der wenigen Nazis, die wirklich welche waren) seine Ehrenbürgerschaften ab, baut riesige Mahnmale, vergibt Ehrendoktorwürden und beklagt den Verlust, der Deutschland durch die Vernichtung der Juden entstanden sei. Opfer, das waren damals irgendwie alle, Opfer von Verhältnissen eben, wie wir sie heute gar nicht mehr kennen – aber Täter? Eine schwierige Frage. Die Richter? Haben halt den Gesetzen entsprochen, die es damals gab. Die Polizisten? Haben nur umgesetzt, was sie gelernt haben. Die Soldaten? Haben bloß ihre Pflicht getan. Die SS? War das reinste Abenteuer und hat sogar einen Literaturnobelpreisträger hervorgebracht. Und überhaupt: Es gab ja keinen Spielraum; man konnte schließlich nichts tun, war daher auch für nichts verantwortlich und litt außerdem selbst unter der Unmenschlichkeit des Krieges.
Was sich nach Oettingers Rede abspielte, war deshalb in jeder Hinsicht bezeichnend. Der Protest blieb zunächst einmal denen überlassen, die man hierzulande – wie immer in solchen Fällen – offensichtlich für zuständig hält: dem Zentralrat der Juden und dem Simon Wiesenthal Center beispielsweise. Erst mit einiger Verspätung reagierte auch das politische Establishment, aber noch nicht mit Rücktrittsforderungen, sondern nur mit dem Appell an Oettinger, sich zu entschuldigen – nicht selten verbunden mit dem Hinweis, er hätte Filbingers „große Lebensleistung“ (Angela Merkel) auch würdigen können, ohne „die kritischen Fragen in Zusammenhang mit der Zeit des Nationalsozialismus“, wie die Bundeskanzlerin Filbingers Tätigkeit als NS-Marinerichter mäßig elegant umschrieb, auszusparen. Die Frage, wie und warum einer wie Filbinger im Nachfolgestaat des Dritten Reichs Karriere machen konnte und nie für seine Taten zur Rechenschaft gezogen wurde, stellte niemand. Kein Wunder: Sie hätte die bundesrepublikanische Lebenslüge von der „Stunde null“ tangiert und die „große Lebensleistung“ des Verstorbenen deutlich kleiner ausfallen lassen, um es zurückhaltend zu formulieren.
 Günther Oettinger geriet zunehmend unter Druck und ließ seiner Entschuldigung für die Wirkung, nicht aber für den Inhalt seiner Rede nach weiterem Drängen nun doch noch einen (vermeintlichen) Widerruf folgen – der in einem nichtssagenden „Ich halte meine Formulierung nicht aufrecht. Ich distanziere mich davon und glaube, dass damit alles (!) gesagt worden ist“ kulminierte. Das war eine Folge davon, dass er mit seinem Versuch, einen Funktionsträger des Nationalsozialismus zum Widerstandskämpfer umzulügen, ein bisschen arg früh dran war. Aber eigentlich hatte er es doch gut gemeint, und deshalb ist seine Entschuldigung bei den Angehörigen und Opfern der Nazis – „Es war mir ernst, und es ist mir ernst“ – gar kein Widerspruch zu seiner Ansprache an die Trauergemeinde des Verblichenen. Indem er dem Modell des Nationalsozialismus ohne Nazis eine prominente Ikone hinzufügte, glaubte Oettinger, mit dem Freispruch eines Mörders zur Wiedergutwerdung der Deutschen beitragen zu können. Doch für ein solch grobschlächtiges Format ist die Zeit noch nicht ganz reif: Vor allem der Widerspruch des Zentralrats verhinderte trotz der unsinnigen Einwilligung in Oettingers „Gesprächsangebot“, dass NS-Schergen mit einer Karriere wie der Filbingers schon jetzt ohne viel Federlesens eingeopfert werden können. Sollte sich daran irgendwann etwas ändern, bliebe als weitere Aufgabe nur noch, Josef Mengele nachträglich den Nobelpreis für Medizin zu verleihen, weil seine Verdienste auf dem Gebiet der Zwillingsforschung eine Lebensleistung für die deutsche Forschung darstellen, die gar zu lange ungewürdigt blieb.
Günther Oettinger geriet zunehmend unter Druck und ließ seiner Entschuldigung für die Wirkung, nicht aber für den Inhalt seiner Rede nach weiterem Drängen nun doch noch einen (vermeintlichen) Widerruf folgen – der in einem nichtssagenden „Ich halte meine Formulierung nicht aufrecht. Ich distanziere mich davon und glaube, dass damit alles (!) gesagt worden ist“ kulminierte. Das war eine Folge davon, dass er mit seinem Versuch, einen Funktionsträger des Nationalsozialismus zum Widerstandskämpfer umzulügen, ein bisschen arg früh dran war. Aber eigentlich hatte er es doch gut gemeint, und deshalb ist seine Entschuldigung bei den Angehörigen und Opfern der Nazis – „Es war mir ernst, und es ist mir ernst“ – gar kein Widerspruch zu seiner Ansprache an die Trauergemeinde des Verblichenen. Indem er dem Modell des Nationalsozialismus ohne Nazis eine prominente Ikone hinzufügte, glaubte Oettinger, mit dem Freispruch eines Mörders zur Wiedergutwerdung der Deutschen beitragen zu können. Doch für ein solch grobschlächtiges Format ist die Zeit noch nicht ganz reif: Vor allem der Widerspruch des Zentralrats verhinderte trotz der unsinnigen Einwilligung in Oettingers „Gesprächsangebot“, dass NS-Schergen mit einer Karriere wie der Filbingers schon jetzt ohne viel Federlesens eingeopfert werden können. Sollte sich daran irgendwann etwas ändern, bliebe als weitere Aufgabe nur noch, Josef Mengele nachträglich den Nobelpreis für Medizin zu verleihen, weil seine Verdienste auf dem Gebiet der Zwillingsforschung eine Lebensleistung für die deutsche Forschung darstellen, die gar zu lange ungewürdigt blieb.Oettingers Pseudo-Distanzierung veranlasste einstweilen die deutschen Regierenden dazu, ein rasches Ende der Debatte zu fordern: „Ich erwarte jetzt, dass die Entschuldigung gehört wird“, sagte Angela Merkel, und Kurt Beck sekundierte: „Herr Oettinger hat seine Aussagen vollständig korrigiert. Das respektiere ich.“ Mehr soll es nicht sein, denn der Ministerpräsident wird vielleicht noch als Visionär gebraucht. Der von Merkel befürchtete „Ansehensverlust Deutschlands im Ausland“ – der GAU also – trat vorerst nicht ein, weil die Kanzlerin höchstselbst versicherte, das Sprechen über die „Perspektiven der Opfer und der Verfolgten“ liege ihr am Herzen. Denn: „Deutschland kann seine Zukunft nur gestalten, wenn es Verantwortung für seine Vergangenheit übernimmt.“ Wie man sich diese Zukunft vorzustellen hat und wie die Verantwortung für die Vergangenheit denn konkret aussehen soll, verschwieg Merkel – wahrscheinlich aus Respekt vor der „großen Lebensleistung“ eines Staatsdieners.
Eine Chance hat Oettinger aber noch: Wenn ihm der Nachweis gelingt, dass Filbinger tatsächlich von den Männern des 20. Juli „zur Verwendung“ vorgesehen war, könnte er die ganz große Nummer werden. „Filbinger hätte, wie es anderen in ähnlicher Lage ergangen ist, mit langer Haft und quälenden Verhören rechnen müssen, wenn man erfahren hätte, dass die Verschwörer auf ihn gerechnet hatten“, heißt es auf der Homepage des zu Grabe Getragenen. Die Gestapo habe Filbinger schlicht übersehen. Das muss diesen so frustriert haben, dass er noch kurz vor dem Kriegsende Todesurteile beantragte, den Befehl zu mindestens einer Exekution gab und auch nach dem Krieg volksfeindliche Elemente wegsperren ließ. Doch selbst wenn die Geschichte mit dem 20. Juli stimmte, änderte sich nichts: In dieser Gruppe gab es bereits reichlich Personal, das zunächst die halbe Welt in Schutt und Asche gelegt hatte, bevor es angesichts des Absehbaren Panik bekam und den Führer loswerden wollte, der gerade den schönen Krieg verlor. Hans Filbinger hätte diese Helden des deutschen Widerstands gut ergänzt. Aber daraus wurde nichts, und so machte er einfach weiter wie bisher und bekleidete später das Amt eines Ministerpräsident. Fürwahr eine deutsche Karriere.
„Ich erinnere mich gerne, wie er auch nach dem Ausscheiden aus der aktiven Politik immer dabei war, wenn die Pflicht rief“, rief Günther Oettinger seinem verflossenen Amtskollegen nach. Der „war streng, er war fürsorglich, er war vorbildlich, er war fleißig, er war sachkundig, er war mutig und weitsichtig und er hat früh Talente und Begabungen erkannt und gefördert“. Kurz: Er war deutsch bis auf die Knochen. Daher hofft der Ministerpräsident: „Bekanntlich ist nur der wirklich tot und vergessen, der aus den Herzen und der Erinnerung der Menschen verschwindet. Ich bin sicher: Hans Filbinger wird weiterleben – in unseren Herzen, in unserer Erinnerung und mit seinem politischen Lebenswerk für uns und die nächsten Generationen.“ Vielleicht kann man dann eines Tages auch mal ohne Widerspruch behaupten, dass Filbinger eigentlich ein zweiter Dreyfus war. So sah er sich nämlich selbst, den „bedeutenden jüdischen Rechtsgelehrten Professor Dr. Ernst Hirsch“ zitierend, der ihn, Emile Zolas „J’accuse“ missbrauchend, zum Verfolgten machte. Denn Opa war schließlich kein Nazi, sondern nur: ein ganz normales deutsches Opfer. Wie so viele im Nationalsozialismus.
Hattips: barbarashm, Gereon L., Gesine, Ulrich S.