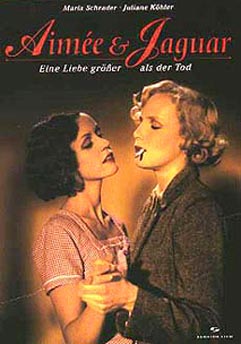Anfang Februar dieses Jahres zitierte der
Stern den Text eines Fotos, das einen Teilnehmer an einer Demonstration militanter Islamisten in London zeigte. Der Mann hielt eine Papptafel, auf der stand:
„Behead those who say Islam is violent“ (
„Köpft die, die sagen, der Islam sei gewalttätig“).
Das Bild war eine Fälschung – aber nicht nur eine gut gemachte, sondern außerdem eine ziemlich hellsichtige:
„Jeder, der den Islam als eine intolerante Religion beschreibt, fördert die Gewalt“, kommentierte beispielsweise
eine Sprecherin des pakistanischen Außenministeriums die Rede des Papstes in Regensburg, paraphrasierte also gewissermaßen das, was ein
Photoshop-Künstler anlässlich des so genannten Karikaturenstreits noch als Fake in Umlauf gebracht hatte.
„Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat und da wirst du nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten“,
hatte Benedikt XVI. den byzantinischen Kaiser Manuel II. zitiert; Grund genug offenbar für eine Vielzahl an Prophetenverehrern weltweit,
erneut zu marodieren und zu brandschatzen, obwohl der Papst es doch nur gut mit ihnen gemeint hatte und sie bloß darauf hinweisen wollte, dass der
„Dialog der Kulturen“ zwingend eine religiöse Basis erfordere, jedoch ohne Gewalt vonstatten zu gehen habe. Stattdessen sah er sich zu einer Klarstellung veranlasst, die jedoch Verwüstungen und hasserfüllte Tiraden bis hin zu Morddrohungen nicht bremsen konnte. Undank ist eben der Welt Lohn.
Dabei waren Benedikts Vorleistungen nicht unbeträchtlich. Bereits die Veröffentlichung der Mohammed-Cartoons hatte er
als „Verletzung religiöser Gefühle“ kritisiert, trotz seiner Verurteilung der Gewaltexzesse also de facto Verständnis für die Randale in der islamischen Welt geäußert. Und auch danach war der Papst vor allem als jemand aufgefallen, der auf
interreligiöse Gespräche steht und darin sozusagen den Schlüssel zum Weltfrieden sieht – ein Ansatz, der auch
seine Regensburger Rede kennzeichnete. Denn in ihr ritt er neuerlich eine Attacke gegen die
„positivistische Vernunft“ und
„die ihr zugehörigen Formen der Philosophie“:
„Von den tief religiösen Kulturen der Welt wird gerade dieser Ausschluss des Göttlichen aus der Universalität der Vernunft als Verstoß gegen ihre innersten Überzeugungen angesehen. Eine Vernunft, die dem Göttlichen gegenüber taub ist und Religion in den Bereich der Subkulturen abdrängt, ist unfähig zum Dialog der Kulturen.“ Christian Geyer kommentierte diese Sätze in der FAZ trocken: „Hatte die Verteidigung des Glaubens ehemals aufwendige ontologische Tüfteleien erfordert (Seinsmetaphysik, Naturrecht), so kann sich die moderne Apologie darauf verlegen, Atheismus als Sicherheitsrisiko zu beschreiben. [...] Nach dem Motto: Eine Kultur, die nicht glaubt, darf sich nicht wundern, wenn sie zur Zielscheibe der islamistischen Aggression wird. So hat es der Papst natürlich nicht gesagt. Aber so ähnlich.“Mehr Gottesfurcht, mehr Frömmigkeit, mehr Spiritualität – so lautet sein Rat an seine Schäfchen und solche, die es (wieder) werden sollen. Denn
„wenn ein atheistisches Konzept des Denkens als ‚Verstoß gegen innerste Überzeugungen’ anderer erscheint, dann ist dieses Konzept per se unzureichend, revisionsbedürftig, versteht man den Papst“, brachte es Christian Geyer auf den Punkt. Und damit setzt Benedikt
„die Erwartungen der ‚tief religiösen Kulturen der Welt’ an den Westen ins Recht“ – also auch den militanten Islam, dessen
„Erfahrungen und Überzeugungen [...] für den Papst insofern ernst zu nehmen [sind], als sie für den Westen einen Imperativ darstellen, die eigene Rationalität nicht länger als Ausschlussformel für Religiosität zu sehen“. Dementsprechend forderte Benedikt in Regensburg eine
„Ausweitung unseres Vernunftbegriffs“ auf den Glauben; ansonsten werde der Mensch
„verkürzt“:
„Das Subjekt entscheidet mit seinen Erfahrungen, was ihm religiös tragbar erscheint, und das subjektive ‚Gewissen’ wird zur letztlich einzigen ethischen Instanz. So aber verlieren Ethos und Religion ihre gemeinschaftsbildende Kraft und verfallen der Beliebigkeit.“ Doris Ladstaetter fasste diesen Gedankengang
in der Neuen Zürcher Zeitung so zusammen: „Der Papst will die westliche Welt wieder hinter das Kreuz Christi scharen, sie zurückholen von den Sekten und dem Konsumwahn. Die Religion soll keine Subkultur sein, kein Zusatz im Leben der Menschen wie ein Hobby.“
Denn das sei gefährlich, folgt man dem Oberhaupt der katholischen Kirche:
„Wir sehen es an den uns bedrohenden Pathologien der Religion und der Vernunft (!), die notwendig (!) ausbrechen müssen (!), wo die Vernunft so verengt wird, dass ihr die Fragen der Religion und des Ethos nicht mehr zugehören. Was an ethischen Versuchen von den Regeln der Evolution oder von Psychologie und Soziologie her bleibt, reicht ganz einfach nicht aus.“ Als Plädoyer gegen Aufklärung und Moderne wollte er das jedoch angeblich nicht verstanden wissen:
„Das Große der modernen Geistesentwicklung wird ungeschmälert anerkannt: Wir alle sind dankbar für die großen Möglichkeiten, die sie dem Menschen erschlossen hat und für die Fortschritte an Menschlichkeit, die uns geschenkt wurden.“ Nur müsse man der
„Bedrohungen, die aus diesen Möglichkeiten aufsteigen“ – als da wären, ohne dass sie diesmal verbalisiert wurden: technischer Fortschritt, Individualismus, Homosexualität, nichtehelicher Geschlechtsverkehr, Frauenrechte, Krieg und allerlei anderer kapitalistischer Schnickschnack –,
„Herr werden“. Zudem gebe es gar keinen prinzipiellen Widerspruch zwischen Glaube und einer christianisierten Vernunft, denn:
„Das Ethos der Wissenschaftlichkeit ist im Übrigen Wille zum Gehorsam gegenüber der Wahrheit und insofern Ausdruck einer Grundhaltung, die zu den Grundentscheiden des Christlichen gehört.“ Womit der ganz private Glaube (!) an die Existenz eines Gottes mal eben auf einer Stufe mit den Erkenntnissen der Natur- und Geisteswissenschaften landet.
Die Rede des Papstes war zweifellos eine taktische Meisterleistung. Denn wie die Reaktionen auf sie in der islamischen Welt ausfallen würden, war abzusehen, und Benedikt dürfte sie bewusst einkalkuliert oder doch zumindest in Kauf genommen haben. Daran ist zunächst einmal nichts Falsches:
„So wie es das Christentum in der freien Welt hinzunehmen hat, wenn man versuchen sollte, es auf seine Kreuzfahrerzeit zu reduzieren, so muss es der Islam hinnehmen, wenn ihm die Frage: ‚Wie hältst du’s mit der Gewalt?’ auch einmal in einer journalistisch zugespitzten Form gestellt wird“,
befand Christian Geyer in einem weiteren Beitrag für die FAZ zu Recht und stellte klar:
„Der Westen muss auch in diesem neuerlichen Fall darauf beharren, dass wir in jedem Fall auf dem Recht bestehen, zu sagen, zu lesen, zu hören und zu sehen, was wir wollen. Wo dies der Verfassung des Gemeinwesens widerspricht, sind die Gerichte zuständig. Alles andere, der rechtspolitische Verweis auf verletzte religiöse Gefühle, führt in eine Rhetorik der Unfreiheit, der Inhumanität.“ Hier liegt jedoch einer der Knackpunkte:
„Jetzt rächt sich, dass man auch im Westen hier und da versucht, den Karikaturenstreit zum Anlass zu nehmen, um religiöse Gefühle unter so etwas wie Artenschutz zu stellen, an dem das Recht auf freie Meinungsäußerung seine Grenze finden soll. Man kann angesichts des aktuellen Eklats nur wieder sagen: Umgekehrt wird ein Schuh daraus.“ Eine nur allzu berechtigte Kritik zum einen an diversen Politikern unterschiedlichster Lager, die Anfang des Jahres die Gelegenheit gekommen sahen,
die Verschärfung des § 166 des Strafgesetzbuches zu fordern statt seiner Abschaffung, zum anderen an den Strafverfolgungsbehörden und Gerichten, die pointierte Kritiker des Islam mit Verfahren überzogen und –
wie etwa im Fall der „Koranrolle“ – mit harten Urteilen bedachten, und schließlich am Papst selbst.
Um nicht missverstanden zu werden: Die
„Pathologien der Religion“, von denen dieser sprach, zeigen sich am Beispiel des Islam – an den er zuvörderst gedacht hatte, mehr jedenfalls als an vergleichsweise unbedeutende Sekten – besonders deutlich: sei es in den
suicide attacks, sei es in New York, Madrid und London, sei es im Iran, sei es angesichts der Ausschreitungen im Zuge der Prophetenzeichnungen – und sei es eben eingedenk der Reaktionen auf die Ansprache Benedikts. Der scheint dadurch also im Recht zu sein und kann auf Zustimmung zählen, wenn er sein Gegengift benennt: eine (Rück-) Besinnung auf Religiosität und eine „göttliche Vernunft“, die allein imstande seien, bei den
„tief religiösen Kulturen der Welt“ Respekt und Verständnis zu wecken, weil man derlei Werte mit diesen teile. Demgegenüber erscheinen Atheismus, Agnostizismus und
„positivistische Vernunft“ als
gemeinsamer Feind, eben als
„Verstoß gegen die innersten Überzeugungen“ gläubiger Menschen – und darüber hinaus als mordsgefährlicher, menschheitsbedrohender Unsinn.

Der Appell verfing umgehend. Bayerns Ministerpräsident
Edmund Stoiber etwa fand, Benedikt verbinde
„persönliche Nähe und starke Emotion mit grundlegenden Aussagen und Wahrheiten für alle (!) Menschen. Ich glaube, er weiß gerade für viele Menschen in Deutschland und der westlichen Welt wieder eine Nähe zu Gott in ihrem Leben herzustellen.“ Und auch Matthias Matussek hatte nach dem Ende der Fußball-WM endlich mal wieder Anlass,
so richtig den Rottweiler von der Leine zu lassen: „Schauen wir uns diejenigen an, die sich bei uns als Gläubige bezeichnen, und schauen wir mit den Augen eines gläubigen Moslems, für den Religion auch immer Ausübung bestimmter Vorschriften bedeutet“, hatte der
Spiegel-Kulturchef den Papst ganz richtig verstanden:
„Wie sieht es bei unseren Katholiken aus, mit Kirchgang, Gebeten, Kommunion, Beichte? Könnte es sein, dass sie vom Islam lernen können?“ Sie können, findet Matussek, und darauf ist er richtig neidisch. Denn wo man auch hinsieht: Lotterleben, materielle Verführungen, und keiner hält sich mehr an die zehn Gebote im
„Land des Relativismus“. Also:
„Was soll denn das für eine Religion sein, würde sich unser Moslem fragen und mit wachsendem Erstaunen zuhören. Was nehmen die denn überhaupt Ernst, wenn sie noch nicht mal das Heiligste Ernst nehmen?“ Konsequenz:
„Unser Moslem jedenfalls würde kopfschüttelnd weiterziehen und den Papst verstehen, der von seinen Landsleuten einen Ruck gefordert hat.“Das ist natürlich barer Unsinn. Denn es bleibt, wie gesehen, nicht beim Kopfschütteln – und daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn sich Christen wieder mehr auf die
„Ausübung bestimmter Vorschriften“ besännen, wie Matussek sich ausdrückte, oder wenn
„wir die selbstverfügte Beschränkung der Vernunft auf das im Experiment Falsifizierbare überwinden und der Vernunft ihre ganze Weite wieder eröffnen“, wie Benedikt seinen Rückruf zum Götzendienst theologisch umschrieb. Ungläubig bleibt ungläubig – zumindest für die, die ihren Propheten wörtlich nehmen und seine Lehren
„mit dem Schwert“ verbreiten wollen. Gut möglich, dass auch der Papst genau weiß, wie wenig sich die Anhänger der
Religion des Friedens darum scheren, ob ihre Feinde nun ihr Leben nach den Regularien ihrer eigenen Kirche ausrichten oder nicht. Falsch verstanden – wie die üblichen Verdächtigen von Hans Küng bis Hans-Christian Ströbele meinten – hat der Papst den Islam in Bezug auf sein Gewaltpotenzial jedenfalls nicht. Das wiederum lässt jedoch eigentlich nur einen Schluss zu: Benedikt hat in seiner Regensburger Rede die reale islamistische Gefahr vor allem als taktischen Kniff, als Aufhänger benutzt, um seine Gläubigen in den Schoß der Kirche zurückzuholen –
das war sein eigentliches Anliegen.
Derlei mag einem Papst ein legitimes Ansinnen sein; schließlich kann man von ihm schlecht verlangen, dass er seinen Verein auflöst und ein Plädoyer dafür hält, der Irrationalität und dem Wahnsinn mit den areligiösen Mitteln der Aufklärung und des Universalismus beizukommen. Aber man kann sein Anliegen zurückweisen und sich ihm verweigern. Denn es ist nicht einzusehen, wenn Benedikt neben den
„Pathologien der Religion“ unversehens auch solche
„der Vernunft“ erblickt, die angeblich
„notwendig ausbrechen müssen“, wenn man diese Vernunft nicht schleunigst um den Faktor „Gott“ erweitert – sie also zurücknimmt. Mag schon sein, dass die
„tief religiösen Kulturen der Welt“ Atheismus und Agnostizismus als
„Verstoß gegen ihre innersten Überzeugungen angesehen“. Das ist aber noch lange kein Grund, Religion nicht dorthin zu verweisen, wo ihr Platz in einer wirklich säkularen Gesellschaft ist:
„in den Bereich der Subkulturen“. Anders gesagt: Religion hat Privatsache zu sein, denn erst diese Voraussetzung hat es,
wie Alan Posener in der Welt feststellte, ermöglicht,
„dass in Europa, einst von blutigen Religionskriegen heimgesucht, die alles in den Schatten stellen, was Muslime einander und uns antun, heute zivilisiert über Vernunft und Glaube diskutiert werden kann“. Dahinter sollte, nein: dahinter darf es kein Zurück geben.

Man muss nicht unbedingt so weit gehen, die Rede des Papstes dahin gehend zu kommentieren, hier solle offenbar der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben werden. Denn eine Religionskritik, die ihre Aufgabe recht versteht, macht nicht alle Glaubensrichtungen und -gemeinschaften einfach gleich. Der Verweis etwa auf die höchst gewalttätigen Kreuzzüge des Christentums führt schon deshalb nicht weiter, weil es nicht Christen sind, die sich derzeit Sprengstoffgürtel umschnallen, Raketen auf Israel schießen, davon träumen, mit der Atombombe den jüdischen Staat zu vernichten, und alles in Schutt und Asche legen, wenn man ihr Allerheiligstes kritisiert oder karikiert, sondern Anhänger des Islam. Insofern muss der Papst verteidigt werden sowohl gegen den islamistischen Furor als auch gegen seine europäischen Kritiker und Appeasement-Fans von Küng bis Ströbele. Aber nicht jeder, der
„Schlechtes und Inhumanes“ am und im Islam findet, hat deshalb automatisch geeignete Gegenrezepte zu bieten. Und die des Papstes taugen nicht, um
„im Stande der Unfreiheit das Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, nichts Ähnliches geschehe“, wie Adorno den kategorischen Imperativ reformulierte. Neu ist das nicht: Bereits im Mai hatte Benedikt ausgerechnet bei einem Besuch im ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz den Nationalsozialismus auf eine gottlose
„Schar von Verbrechern mit lügnerischen Versprechungen“ heruntergebrochen, der die Deutschen schuldlos erlegen seien, so,
„als sei das Versprechen, Deutschland judenrein zu machen und zur Weltmacht zu führen, nur abzulehnen, weil es am Ende anders kam“ (Alan Posener), und so, als habe es nicht einen Zusammenhang zwischen Vernichtung und Volkswohlstand gegeben, von dem dann doch erheblich mehr profitierten als bloß ein paar Nazi-Größen.
Die Therapie gegen den Wahn einer zur politischen Ideologie geronnenen Religion besteht gerade
nicht darin, Verständnis für deren Abneigung nicht bloß vermeintlicher oder tatsächlicher Auswüchse des Kapitalismus, sondern universeller – also nicht bloß „westlicher“ – Werte als solcher zu zeigen und daraus die Konsequenzen zu ziehen, dass es erstens einer verstärkten Gottesfurcht in den westlichen Gesellschaften und zweitens des Zusammenschlusses der Religionen unter dem Banner des
„Dialogs der Kulturen“ gegen einen die Welt angeblich bedrohenden Säkularismus bedarf. Notwendig wären vielmehr eine noch stärkere Trennung zwischen Kirche und Staat, eine vehemente Stärkung der Aufklärung gegen den Irrationalismus und ein noch weitergehendes Zurückdrängen der Religion in den privaten Bereich sowie ein unmissverständliches Plädoyer für das grundsätzliche Recht auf Blasphemie und für den Universalismus einer allen religiösen Versuchungen entsagenden Vernunft. Alles andere ist günstigstenfalls eine Verschlimmbesserung. Agnostiker und Atheisten haben es schon schwer genug.
Hattip: barbarashm
 Es ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass UN-Beschlüsse erst einmal nur ein Stück Papier sind, das bekanntlich geduldig ist. Und nicht selten ist das auch gut so – würden alle Resolutionen so umgesetzt, wie ihr Wortlaut es vorsieht, gäbe es den Staat Israel vermutlich längst nicht mehr. Andere Entschließungen wiederum gewähren einen gewissen Spielraum; auch das kann durchaus sinnvoll sein, schließlich lässt sich nicht alles bis ins Detail am Reißbrett entwerfen. Und manche Dekrete sind in der Theorie und noch mehr in der Praxis schlicht eine völlige Farce. Zur letztgenannten Kategorie gehört der Beschluss mit der Nummer 1701, verabschiedet im Zuge des Waffenstillstandes zwischen der Hizbollah und Israel. War schon das, was da auf eitel Bütten niedergeschrieben wurde, eine tragikomische Angelegenheit, erweist sich deren konkrete Umsetzung nachgerade als Realsatire, über die sich jedoch allenfalls bitter lachen lässt.
Es ist ja durchaus nicht ungewöhnlich, dass UN-Beschlüsse erst einmal nur ein Stück Papier sind, das bekanntlich geduldig ist. Und nicht selten ist das auch gut so – würden alle Resolutionen so umgesetzt, wie ihr Wortlaut es vorsieht, gäbe es den Staat Israel vermutlich längst nicht mehr. Andere Entschließungen wiederum gewähren einen gewissen Spielraum; auch das kann durchaus sinnvoll sein, schließlich lässt sich nicht alles bis ins Detail am Reißbrett entwerfen. Und manche Dekrete sind in der Theorie und noch mehr in der Praxis schlicht eine völlige Farce. Zur letztgenannten Kategorie gehört der Beschluss mit der Nummer 1701, verabschiedet im Zuge des Waffenstillstandes zwischen der Hizbollah und Israel. War schon das, was da auf eitel Bütten niedergeschrieben wurde, eine tragikomische Angelegenheit, erweist sich deren konkrete Umsetzung nachgerade als Realsatire, über die sich jedoch allenfalls bitter lachen lässt.